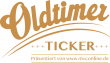von Simone Lingner / Technik Museum Sinsheim
1907 fand die wohl mit Abstand härteste Rallye der damaligen Zeit statt: von Peking nach Paris. 90 Jahre später wurde das historische Rennen wiederholt. Museumspräsident Hermann Layher und Oldtimer-Experte Jörg Holzwarth waren mutig genug, am 6. September 1997 an diesem harten Marathon zu starten. 2022 jährt sich das Ereignis zum 25. Mal – ein guter Grund mit den Herren in Erinnerungen zu schwelgen.
Bei dieser Rallye waren die Fahrer das größte Verschleißteil
Am 31. Januar 1907 brachte eine provokante Frage West-Europa in Aufruhr: Wer schafft eine Rallye von Peking nach Paris. Prince Borghese bewältigte die Strecke mit einem Itala in 60 Tagen. 90 Jahre später wurde das historische Rennen wiederholt. Museumspräsident Hermann Layher und Oldtimer-Experte Jörg Holzwarth waren mutig genug, am 6. September 1997 an diesem harten Marathon zu starten. 2022 jährt sich das Ereignis zum 25. Mal – ein guter Grund mit den Herren in Erinnerungen zu schwelgen.
Die Erfindung des Automobils, der motorisierte Kutschenersatz, faszinierte. Um ihre Produkte zu testen, veranstalteten die Automobilhersteller um 1900 die unterschiedlichsten Rennen. Damit wollten sie beweisen, dass ihr Gefährt am besten, schnellsten, zuverlässigsten war. Mit den Jahren wurden die Strecken länger und gefährlicher. Für die Sieger regnete es Geld, Ruhm und Ehre. So auch beim Gewinner des Peking-Paris Rennens 1907 Scipione Borghese. Als die Idee aufkam diese Rallye wieder aufleben zu lassen, war der damalige Leiter der Technik Museen Sinsheim Speyer, Hermann Layher, Feuer und Flamme.
Bereits als Schüler verschlang er Luigi Barzinis Werk „Peking-Paris im Automobil“. Die Bilder mit dem durch eine Brücke gestürzten Itala haben sich bei dem jungen Hermann eingebrannt. Am Steuer kein geringer als der Italiener Borghese. „Deshalb war es für mich klar, wenn wir die Tour 1997 fahren, dann nur im Stil von Borghese“, erinnert sich der heutige Museumspräsident. „Ich wollte erleben, was er 90 Jahre zuvor erlebte. Die hatten ja gar keine Straßen und das Auto ähnelte dem American La France.“ Sein Mitarbeiter, Jörg Holzwarth, stimmte dem Vorhaben sofort zu. Nur den Organisator der Revival-Rallye überkamen dabei Sorgen. Da das Rennen eigentlich nur für Nachkriegsfahrzeuge vorgesehen war, hatte er auf eine Baujahresgrenze nach unten verzichtet. Er rechnete nicht damit, dass einer auf die wahnsinnige Idee kommt, 16.000 Kilometer in einem 90 Jahre alten Gefährt zu bestreiten. So ging der Funkenblitz als das älteste Fahrzeug an den Start. Einzige Voraussetzung: Es mussten Kotflügel dran. „So ein altes Auto vermittelt dir mehr von allem. Du hast die Landschaft im Arm, wenn du so obendrauf sitzt. Du atmest und riechst es. Die Gerüche und Bilder in China, werde ich nie vergessen. Das war unglaublich. Die Eindrücke sind nach 25 Jahren erstaunlich frisch“, stellt Layher fest.
Eigentlich war das Team gut vorbereitet. Aber eine Rallye hat ihre eigenen Regeln und wie es aussieht, bereitet einen nichts darauf vor. Bis auf ein gebrochenes Auslassventil ist der 95 PS-starke Klassiker gut durch das Reich der Mitte gekommen – anders als die Fahrer. In ihrer Leichtsinnigkeit ließen sie alle guten Vorschläge an sich abprallen. Immerhin kamen die beiden anfangs ja gut zurecht. Und China nahm sie ganz in ihren Bann. Was sie alles aus den Büchern über dieses gewaltige Land zu wissen glaubten, hatte sie nicht annähernd auf das vorbereitet, was sie erlebten. Das tägliche Leben, die Kultur und Landschaft waren überwältigend.
Und dann ging es Richtung Himalaya. Die Luft wurde kälter, Graupelschauer und Schneefall setzten ein. Die beiden verharrten stundenlang auf den Sitzen zusammengekauert in einer Position. Da die Motorhaube tiefer sitzt, lag auch die komplette Brust ab der Gürtelschnalle nach oben frei. Dem eisigen Fahrtwind waren sie schutzlos ausgesetzt. „Wir hatten schon gute Kleidung. Aber der Reißverschluss daran war der Schwachpunkt. Der permanente Winddruck, Regen und das Schneetreiben, haben das Wasser durch den Reißverschluss gedrückt. Somit hat es sich unter der Jacke verbreitet und wir kühlten langsam aus. Uns fehlte eine Windschutzscheibe“, so Holzwarth. „Die Fahrer waren das größte Verschleißteil bei dieser Rallye“, heute kann der Museumspräsident darüber lachen. Vor einem Vierteljahrhundert sah es noch anders aus. Irgendwo im Hochgebirge fiel er dann ohnmächtig vom Sitz. Zwei Schafhirten zogen ihn in ein Zelt, dort kam er wieder zu sich. Daran fehlt ihm aber jegliche Erinnerung. Sein Mitstreiter, selbst durchnässt und schwach auf den Beinen, brachte seine letzten Kraftreserven auf und organisierte Verstärkung. Mit einem Auto transportierten sie Hermann Layher zurück ins Tal. Einheimische halfen dem damals 25-Jährigen Holzwarth, den erkrankten Museumsleiter wieder aufzupäppeln. Der Rallye-Arzt diagnostizierte eine doppelte Lungenentzündung und verbot ihm die Weiterfahrt. Dann ging es mit der Bahn zurück nach Peking und anschließend Heim nach Sinsheim. „Eine Weiterfahrt mit dem intakten Funkenblitz haben alle Mitstreiter dankend abgelehnt“, ergänzt Layher schmunzelnd.
In Deutschland angekommen, nagte die Tatsache, die Tour nicht beendet zu haben, sehr an den beiden. Wieder genesen, flogen sie nach Istanbul und setzten von da aus die Revival-Rallye fort. Es ging über Griechenland und Italien nach Paris. So haben sie die Tour am 18. Oktober 1997 außerhalb der Wertung aber mit Anstand zu Ende gebracht. Eine Finisher Medal in Bronze gab es obendrauf. Sie wussten, sie hätten sich mehr auf diese Tour vorbereiten müssen: längere Strecken fahren und das bei jedem Wetter.
Rückblickend betrachtet, veränderte die Revival-Rallye nicht nur ihre Kleiderwahl bei Ausfahrten. Lange muss Jörg Holzwarth darüber nicht nachdenken: „Wenn man aus dem 700-Seelenort Eibensbach kommt, dann ist man eher schüchtern und in der Fremde – als Schwabe sowieso – zurückhaltend. Man hat Angst vor allen Leuten. Und die Menschen, die unseren Weg kreuzten, hätten uns in der Wüste vergraben können. Es wäre nicht aufgefallen, dass wir fehlen. Aber sie waren so gastfreundlich, nett und halfen uns in unserer größten Not. Heute gehe ich offen durchs Leben. Ich weiß, Gastfreundlichkeit wird auf der ganzen Welt sehr großgeschrieben und es möchte nicht jeder etwas Böses.“ Dem kann Museumspräsident Layher nur zustimmen, und geht dabei noch einen Schritt weiter: „Ich habe gelernt, groß zu denken. Wenn du dort in einem Zelt liegst, hyperventilierst und nur das verzweifelte Schreien eines Yaks unterbricht das laute Schneetreiben – dieses Gefühl vergisst du nie. Mittlerweile weiß ich, ein Abenteuer ist, solange du es erlebst, meistens nicht erfreulich. Das wird erst hinterher schön. Wenn du etwas möchtest, mach es einfach. Und fragen kostet ja auch nichts.“ Und so tat er es auch: Er holte mit den Museumsmitgliedern einen Jumbo-Jet und einen Raumgleiter nach Speyer, stellte die Concorde auf das Museumsdach in Sinsheim. Der Peking-Paris-Erfahrung haben Layher und Holzwarth es zu verdanken, dass die motorisierte Fangemeinde einen 47-Liter-Hubraummonster hat. Die Erfahrung von 1997 inspirierte die beiden dazu, den Brutus zu bauen. „Ich verstand, das nächste Abenteuer ist einen Häuserblock entfernt. Du kannst nicht durch die Wüste Gobi fahren und später Gänseblümchen züchten. Das passt nicht“, bringt es Layher auf den Punkt. Seit 2013 ist er Museumspräsident vom größtem privat geführten Museum Europas und hat noch einiges vor.
Die Frage, ob sie das Rennen nochmals fahren würden, lässt beide etwas innehalten. „Den Himalaya verpasst zu haben, das reut mich ein bisschen. Die vor uns liegende Strecke wäre, technisch gesehen, perfekt für den Funkenblitz gewesen,“ so Holzwarth. Der American La France hat keine Stoßdämpfer, demnach können diese nicht kaputt gehen, verfügt aber über Blattfedern und einen stabilen Rahmen – perfekt für dieses Terrain. War die sonst normale kilometerlange Fahrt für das Automobil weniger angenehm, hätte es im Gelände eine größere Durchschnittsgeschwindigkeit, aufgrund der einfachen Technik, hinbekommen. „Wenn ich die Bilder vom Himalaya sehe, so bereiten mir diese immer noch körperliche Schmerzen. Und dann die Straße runter vom Everest. Auf dem Friendship Highway hatten alle Mitstreiter Angst. Aber wir sind ja geländeerfahren. Ich wusste schon damals, dass wir es schaffen“, ist Layher überzeugt. Trotzdem sind beide der Meinung, dass es vor 25 Jahre nicht anders hätte kommen können.