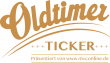1. Januar 1938: Behörden können Kraftfahrzeughalter verpflichten, ihre Fahrzeuge sachverständigen zur technischen Prüfung vorzustellen. 1. Dezember 1951: Die regelmäßige Vorstellung von Kraftfahrzeugen zur technischen Prüfung wird Pflicht. Die Behörden fordern die Halter auf, ihr Fahrzeug zu einem bestimmten Tag in einem bestimmten Ort vorzustellen. Das zu dieser Zeit gravierendste technische Problem: Beleuchtung. Insgesamt fallen mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln auf. Ab 1956 erfolgt die Umstellung der Kraftfahrzeug-Kennzeichen auf das heutige System: schwarze Schrift auf weißem Grund, fortan ist die Zuordnung auf den Zulassungsbezirk bezogen, also Landkreis oder kreisfreie Stadt. Ein zu beobachtender Rückgang von erheblichen Mängeln wird auf die steigende Zahl von Neufahrzeugen zurückgeführt. 1959: Das asymmetrische Abblendlicht wird eingeführt. Der Mängelbericht wird jetzt als Karte ausgegeben, dessen Rand entsprechend der festgestellten Mängel gelocht wird. Auswertungen der Befunde sind jetzt wesentlich schneller. 1961: Immer noch kommen nur rund 50 Prozent der prüfpflichtigen Fahrzeuge zur Hauptuntersuchung. Ab jetzt gibt es eine Plakette, die bei bestandener Prüfung auf das Kennzeichen geklebt wird; sie gibt Aufschluss darüber, wann das Fahrzeug wieder zur Prüfung vorgestellt werden muss. Die Mängelaufteilung zwischen den Mängelgruppen verschiebt sich, weil nicht nur die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs, sondern auch seine Übereinstimmung mit den gesamten Bestimmungen der StVZO zu prüfen ist. 1962: Gravierende Mängel: schlecht eingestellte Scheinwerfer, verfärbte Rück- und Blinkleuchten, korrodierte Bremsleitungen, mangelhafte Handbremsen, abgenutzte Ersatzbereifung. 1963: Die Plakette gibt jetzt den Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung an. Die Prüfung muss dann innerhalb der kommenden zwei Monate erfolgen. Straßenverkehrsämter sind nicht mehr für die fristgerechte HU zuständig. 1964: Kfz-Zulassungsstellen verschicken nun keine Aufforderungen mehr an die Fahrzeughalter, ihr Fahrzeug zur Hauptuntersuchung vorzuführen. Ab sofort ist der Halter selbst verpflichtet, selbst für die fristgerechte Prüfung der Fahrzeuge zu sorgen. 1965: 30 Prozent der Fahrzeuge haben Mängel an der Beleuchtung, 22 an Bremsen. Es gibt Diskussionen, Fahrzeuge, drei Jahre nach Erstzulassung zur HU vorzustellen statt bislang nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren haben 20 Prozent der Pkw erhebliche Mängel. Nach drei Jahren sind es 26 Prozent. 1966: Keine große Resonanz bringt das versuchsweise Einführen der Hauptuntersuchung am Sonnabend beim TÜV Norddeutschland. 1970: Weniger als die Hälfte der geprüften Fahrzeuge sind mängelfrei. 1971: Prüfberichte werden künftig mit der EDV ausgewertet, der Mängelbericht in Kartenform wird durch den so genannten Strichmarkierungsbeleg ersetzt. 1981: Rund 98 Prozent der befragten Kunden (34.000) bescheinigen dem TÜV Norddeutschland eine kundenfreundliche Abwicklung der Prüfung. 1982: Neuwagen müssen künftig erst nach drei Jahren zum erstenmal zur Hauptuntersuchung. 1. April 1985: Die Abgassonderuntersuchung (ASU) wird Pflicht. 1986: Ein Viertel der Kraftfahrzeuge leidet unter Rostproblemen. 1988: Die fachliche Anforderung an die Hauptuntersuchung steigt: Die Elektronik dringt zunehmend in Bereiche vor, für die es früher fast ausschließlich mechanische Lösungen gab. 1. Dezember 1993: Die Abgasuntersuchung (AU) ersetzt die ASU: Damit müssen sich nun auch Fahrzeuge mit Katalysatoren und Dieselfahrzeuge der Abgaskontrolle unterziehen. Mehr Informationen und andere Artikel im Internet.“
1. Januar 1938: Behörden können Kraftfahrzeughalter verpflichten, ihre Fahrzeuge sachverständigen zur technischen Prüfung vorzustellen. 1. Dezember 1951: Die regelmäßige Vorstellung von Kraftfahrzeugen zur technischen Prüfung wird Pflicht. Die Behörden fordern die Halter auf, ihr Fahrzeug zu einem bestimmten Tag in einem bestimmten Ort vorzustellen. Das zu dieser Zeit gravierendste technische Problem: Beleuchtung. Insgesamt fallen mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln auf. Ab 1956 erfolgt die Umstellung der Kraftfahrzeug-Kennzeichen auf das heutige System: schwarze Schrift auf weißem Grund, fortan ist die Zuordnung auf den Zulassungsbezirk bezogen, also Landkreis oder kreisfreie Stadt. Ein zu beobachtender Rückgang von erheblichen Mängeln wird auf die steigende Zahl von Neufahrzeugen zurückgeführt. 1959: Das asymmetrische Abblendlicht wird eingeführt. Der Mängelbericht wird jetzt als Karte ausgegeben, dessen Rand entsprechend der festgestellten Mängel gelocht wird. Auswertungen der Befunde sind jetzt wesentlich schneller. 1961: Immer noch kommen nur rund 50 Prozent der prüfpflichtigen Fahrzeuge zur Hauptuntersuchung. Ab jetzt gibt es eine Plakette, die bei bestandener Prüfung auf das Kennzeichen geklebt wird; sie gibt Aufschluss darüber, wann das Fahrzeug wieder zur Prüfung vorgestellt werden muss. Die Mängelaufteilung zwischen den Mängelgruppen verschiebt sich, weil nicht nur die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs, sondern auch seine Übereinstimmung mit den gesamten Bestimmungen der StVZO zu prüfen ist. 1962: Gravierende Mängel: schlecht eingestellte Scheinwerfer, verfärbte Rück- und Blinkleuchten, korrodierte Bremsleitungen, mangelhafte Handbremsen, abgenutzte Ersatzbereifung. 1963: Die Plakette gibt jetzt den Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung an. Die Prüfung muss dann innerhalb der kommenden zwei Monate erfolgen. Straßenverkehrsämter sind nicht mehr für die fristgerechte HU zuständig. 1964: Kfz-Zulassungsstellen verschicken nun keine Aufforderungen mehr an die Fahrzeughalter, ihr Fahrzeug zur Hauptuntersuchung vorzuführen. Ab sofort ist der Halter selbst verpflichtet, selbst für die fristgerechte Prüfung der Fahrzeuge zu sorgen. 1965: 30 Prozent der Fahrzeuge haben Mängel an der Beleuchtung, 22 an Bremsen. Es gibt Diskussionen, Fahrzeuge, drei Jahre nach Erstzulassung zur HU vorzustellen statt bislang nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren haben 20 Prozent der Pkw erhebliche Mängel. Nach drei Jahren sind es 26 Prozent. 1966: Keine große Resonanz bringt das versuchsweise Einführen der Hauptuntersuchung am Sonnabend beim TÜV Norddeutschland. 1970: Weniger als die Hälfte der geprüften Fahrzeuge sind mängelfrei. 1971: Prüfberichte werden künftig mit der EDV ausgewertet, der Mängelbericht in Kartenform wird durch den so genannten Strichmarkierungsbeleg ersetzt. 1981: Rund 98 Prozent der befragten Kunden (34.000) bescheinigen dem TÜV Norddeutschland eine kundenfreundliche Abwicklung der Prüfung. 1982: Neuwagen müssen künftig erst nach drei Jahren zum erstenmal zur Hauptuntersuchung. 1. April 1985: Die Abgassonderuntersuchung (ASU) wird Pflicht. 1986: Ein Viertel der Kraftfahrzeuge leidet unter Rostproblemen. 1988: Die fachliche Anforderung an die Hauptuntersuchung steigt: Die Elektronik dringt zunehmend in Bereiche vor, für die es früher fast ausschließlich mechanische Lösungen gab. 1. Dezember 1993: Die Abgasuntersuchung (AU) ersetzt die ASU: Damit müssen sich nun auch Fahrzeuge mit Katalysatoren und Dieselfahrzeuge der Abgaskontrolle unterziehen. Mehr Informationen und andere Artikel im Internet.“