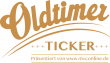2. Teil der Serie zum 175. Geburtstag von Gottlieb Daimler.
2. Teil der Serie zum 175. Geburtstag von Gottlieb Daimler.
Stan Peschl, Mitarbeiter im Konzernzarchiv von Daimler, gibt bei seinen Streifzügen durch das Daimler-Konzernarchiv im Daimler-Blog Einblicke in die Firmengeschichte.
Während Daimler in Karlsruhe die Maschinenfabrik geschäftlich saniert, erweitern die beiden Inhaber der Kölner Gasmotorenfabrik Deutz, der Ingenieur Eugen Langen und der Erfinder Nikolaus August Otto, nach dem Krieg die wirtschaftliche Basis ihrer Fabrik und machen daraus eine Aktiengesellschaft. Betriebsgrundlage ist eine atmosphärische Gaskraftmaschine Ottos. Langen entscheidet sich für den erfahrenen Gottlieb Daimler als Betriebsleiter für die Werkstätten und das Zeichenbüro. Maybach arbeitet als Leiter der Konstruktionsabteilung an der Verbesserung des Gasmotors, dessen Leistungsfähigkeit wegen seiner Größe und seines Gewichts aber begrenzt ist. Otto nimmt daher seine Versuche mit dem Viertaktprinzip wieder auf, was 1876 auch zum Erfolg führt: die Viertakt-Kompressionsmaschine. Doch der Motor ist selbstverständlich noch nicht völlig serienreif. Ihn so weit zu bringen, ist die Aufgabe von Daimler und Maybach. Sie optimieren den Motor und machen daraus einen Verkaufsschlager.
Daimler hatte schon damals die Vision von einem kleinen, universell einsetzbaren Motor. Doch diese Vision lässt sich in Verbindung mit der Gasmotorenfabrik Deutz nicht realisieren, zumal starke Spannungen zwischen Daimler und Otto bestehen. 1882 wird schließlich Daimler gekündigt. Daraufhin veranlasst er Maybach, die Firma auch zu verlassen, um mit ihm zusammen an der Entwicklung eines leichten, schnell laufenden Motors zu arbeiten, von der beide ahnen, dass sie die „Kapitalerfindung“ sein wird. Als neuen Wohn- und Arbeitssitz wählt Daimler Cannstatt in unmittelbarer Nähe zur Residenzstadt Stuttgart, wohl um die Heilkraft der dortigen Quellen für sein Herzleiden zu nutzen, und sichert sich Maybachs Mitarbeit durch einen Vertrag „…für die Durchführung diverser Projekte und Probleme im maschinentechnischen Bereich, welche ihm von Herrn Daimler aufgetragen werden.“
Im Juli 1882 zieht dann Daimler mit seiner Familie in das neu erworbene Haus samt Garten und geräumigem Gartenhaus in der Taubenheimstraße 13 ein. Das Gartenhaus wird umgebaut und erweitert. Der Vorraum beherbergt Schreibtisch und Kommode und wird als Büro genutzt. Der anschließende helle und lichte Raum wird durch den Einbau von Werkzeugbank und Schmiede das Refugium der beiden Ingenieure. Bald regt sich handwerkliches Leben im Gartenhaus. Beide Männer beginnen einen leichten und schnell laufenden Benzinmotor zu entwickeln und zu bauen, der sich für den Einbau in Kutschen, Lastkarren, Booten, Schiffen, Eisenbahn- und Straßenbahnwagen, landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, Feuerwehrpumpen und sogar in Luftschiffen eignen soll. Dafür versuchen sie zunächst das alte Problem der Zündung in den Griff zu bekommen. Maybach arbeitet sich durch zahllose Patentschriften und findet schließlich den Hinweis auf die Möglichkeit einer ungesteuerten Glührohrzündung die sich für die angestrebten hohen Drehzahlen als geeignet erweist. Nach Überwindung dieser Hürde geht es um das Arbeitsverfahren. Aus der Tätigkeit in Deutz war beiden das Viertaktprinzip bestens vertraut. Sie wählen es.
1883 gibt Daimlers Traum seine ersten Töne von sich – er läuft. Der Motor mit einen Hubraum von ca. 100 cm³ leistet 0,25 PS bei sensationellen 600 Umdrehungen, dreimal so viel wie die Deutzer Gasmotoren, und er ist leicht. Mit ihm sind erste wesentliche Konstruktionsziele erreicht. Die folgende verbesserte Ausführung verwandelt den zunächst liegend gebauten Motor in einen stehenden, der unter dem griffigen Namen „Standuhr“ bekannt wird. Die „Standuhr“ bildet die Basis der Patentanmeldung, die schließlich unter dem Datum des 3. April 1885 und der DRP-Nummer 34926 Daimlers Vision öffentlich macht.
Daimler und Maybach montieren den Motor auf ein Zweirad, einem höchst kostengünstigen Versuchsträger. 1885 legt einer der Söhne Daimlers – Adolf – mit diesem ersten Motorrad der Welt die 3 km lange Strecke zwischen Cannstatt und Untertürkheim ohne Probleme zurück. Der Einbau in eine Kutsche – einer „Americain“, dunkelblau mit roten Zierstreifen, schwarzen Ledersitzen und einer „Laterne mit Schein“, so steht es im Lieferschein der Wagenbaufirma Wimpf & Sohn in Stuttgart vom Frühjahr 1887 – ist der nächste Schritt. Das „Motorkutsche“ genannte Gefährt erreicht mit der „Standuhr“ und ihren 1,5 PS immerhin schon 16 Stundenkilometer.
Fortsetzung folgt.