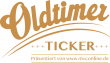Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 2. März klargestellt, dass für die fiktive Abrechnung eines Unfallschadens mit wirtschaftlichem Totalschaden grundsätzlich nur der Wiederbeschaffungswert anzusetzen ist. Die höheren Kosten für die tatsächliche Wiederherstellung eines Oldtimers, von dem ein baugleiches Modell nicht mehr zu beschaffen ist, muss die ersatzpflichtige Versicherung dagegen nicht ersetzen (AZ: VI ZR 144/09).
Der Kläger war Eigentümer eines Wartburgs 353, Erstzulassung 1966, ausgestattet mit Rahmen- und Sonderausrüstungen eines Wartburg 353 W. Dieses Fahrzeug erlitt bei einem Verkehrsunfall einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Wiederbeschaffungswert wurde vom Kläger mit 1.250 Euro ermittelt. Dieser Betrag wurde von der Beklagten an den Kläger vorgerichtlich erstattet.
Der Kläger verlangte jedoch weiteren Schadensersatz in Höhe der Differenz zu den ermittelten Netto-Reparaturkosten in Höhe von 2.462,90 Euro. Ein vergleichbares Fahrzeug sei nach Aussage des Klägers auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht zu erwerben. Um das beschädigte Fahrzeug wiederherzustellen, sei es erforderlich, einen Wartburg 353 zu erwerben und diesen dann mit Originalteilen auf einen Wartburg 353 W umzubauen.
Wiederbeschaffungswert ist entscheidend
Der BGH entschied, dass der Kläger lediglich Anspruch auf Schadensersatz in Höhe des Wiederbeschaffungswerts habe. Dies gelte unabhängig davon, ob eine Wiederherstellung möglich sei oder nicht. Ein Ersatz der Reparaturkosten bis zu 30 Prozent über dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs könne nur dann verlangt werden, wenn die Reparatur sach- und fachgerecht entsprechend dem Sachverständigengutachten durchgeführt wird. Im vorliegenden Fall waren jedoch die Reparaturkosten fast doppelt so hoch wie der Wiederbeschaffungswert.
Insofern sei hier die Höhe der Entschädigung beschränkt auf den vom Kläger selbst ermittelten Wiederbeschaffungswert in Höhe von 1.250 Euro. Die Ansicht des Klägers, es seien die Besonderheiten des Oldtimermarkts zu berücksichtigen, wobei die Reparaturkosten als geeignete Schätzgrundlage anzusehen seien, folgte der BGH nicht.
Auszug aus der Urteilsbegründung
1. Gemäß § 249 Abs. 1 BGB hat der zum Schadensersatz Verpflichtete den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ist wegen der Verletzung einer Person oder der Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Geschädigte gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Für die Berechnung von Fahrzeugschäden stehen dem Geschädigten regelmäßig zwei Wege der Naturalrestitution zur Verfügung: Reparatur des Unfallfahrzeugs oder Anschaffung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeugs (vgl. Senat BGHZ 154, 395, 397 f.; 162, 161, 165; 181, 242 ff., = VersR 2009, 1092 Rn. 13, jeweils m.w.N.).
Das gilt aber nur, wenn eine Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeugs im Rechtssinne möglich ist. Dies ergibt sich aus § 251 Abs. 1 BGB (vgl. dazu Senatsurteile BGHZ 102, 322 ff. und vom 9. Dezember 2008 – VI ZR 173/07 – VersR 2009, 408 f.; BGH, Urteil vom 22. Mai 1985 – VIII ZR 220/84 – NJW 1985, 2413 ff.). Dessen Voraussetzungen könnten allerdings wie das Berufungsgericht annimmt, vorliegen. Immerhin hat der Kläger nach den Feststellungen des Berufungsgerichts vorgetragen, dass es sich bei seinem beschädigten Fahrzeug um ein Unikat und damit Gesamtkunstwerk handele, und dass auch ein vergleichbares Fahrzeug im Hinblick auf die vom Kläger individuell vorgenommenen Veränderungen nicht zu erwerben ist.
Letztlich kann die Frage, ob § 251 Abs. 1 BGB im Streitfall Anwendung findet, aber dahinstehen. Denn der dem Kläger zustehende Schadensersatzanspruch ist unabhängig davon auf die Höhe des Wiederbeschaffungswerts beschränkt, ob eine Wiederherstellung möglich ist oder nicht. Ist eine Wiederherstellung im Rechtssinne möglich, so kann der Kläger nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. z.B. BGHZ 162, 161, 167 f.) nur den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs verlangen, weil er fiktiv abrechnet und die Kosten für eine Reparatur des Fahrzeugs fast doppelt so hoch sind wie der Wiederbeschaffungswert.
Der Ersatz von Reparaturkosten – bis zu 30 Prozent über dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs – könnte nur verlangt werden, wenn die Reparatur fachgerecht und in einem Umfang ausgeführt wird, wie ihn der Sachverständige zur Grundlage seiner Schätzung gemacht hat (vgl. Senatsurteil BGHZ 162, 161, 169). Ist die Wiederherstellung unmöglich, besteht der Anspruch des Klägers auf Geldentschädigung gleichfalls nur in Höhe des Wiederbeschaffungswerts. Der Wiederbeschaffungswert ist bei Kraftfahrzeugen in Fällen der vorliegenden Art sowohl hinsichtlich der Restitution als auch hinsichtlich der Kompensation ein geeigneter Maßstab für die zu leistende Entschädigung.
2. Das Berufungsgericht hat den Wiederbeschaffungswert ohne Rechtsfehler auf 1.250 Euro geschätzt (§ 287 ZPO). Soweit die Revision geltend macht, insoweit seien die Besonderheiten des Oldtimermarkts zu berücksichtigen, wobei die Reparaturkosten die zutreffende Schätzgrundlage seien, kann dem nicht gefolgt werden. Mit Recht weist die Revisionserwiderung darauf hin, dass der vom Berufungsgericht angenommene Wiederbeschaffungswert der vom Kläger selbst vorgelegten Wertermittlung entnommen ist und dass der Kläger selbst vorgetragen hat, Fahrzeuge vom Typ Wartburg 353 W seien am Markt ohne Weiteres für 1.200 Euro zu erwerben.
Darüber hinaus gehende Marktpreise, die etwa durch die Eigenschaft des Fahrzeugtyps als Oldtimer geprägt sind und auf Spezialmärkten für Oldtimer erzielt werden, vermag die Revision nicht aufzuzeigen. Auf den Wert des Materials und der Arbeitsleistung für die vom Kläger in Eigenarbeit vorgenommene Umrüstung seines Fahrzeugs kann nicht abgestellt werden (vgl. Senatsurteil BGHZ 92, 85, 92 f.).