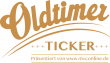Das Jahr 2013 hat uns so einiges an interessanten Modellen aus Russland gebracht, nicht zuletzt die ersten drei Modelle – allesamt nach Vorbildern aus dem Hause mit dem Stern – des neuen Kleinstherstellers A. Golovin, der seine 1:43 Resine-Modelle unter dem Namen „Kleincoche“ vertreibt. Allein schon dieser Name ist interessant, verbindet er doch das deutsche Wort „klein“, mit dem Französischen „coche“, zu Deutsch „Kutsche“; und so verwundert es auch nicht, dass als Logo eine Kutsche fungiert. Bereits das erste „Kleincoche“-Modell sorgte für eine Überraschung, handelte es sich doch hierbei nicht wieder um eine weitere Karosserie-Variante eines 500K oder eines 540K, sondern um die Miniaturisierung des viersitzigen Mercedes-Benz „S“ von 1928 mit einer Karosserie von Buhne, aus Berlin (Bild 1).
Das Jahr 2013 hat uns so einiges an interessanten Modellen aus Russland gebracht, nicht zuletzt die ersten drei Modelle – allesamt nach Vorbildern aus dem Hause mit dem Stern – des neuen Kleinstherstellers A. Golovin, der seine 1:43 Resine-Modelle unter dem Namen „Kleincoche“ vertreibt. Allein schon dieser Name ist interessant, verbindet er doch das deutsche Wort „klein“, mit dem Französischen „coche“, zu Deutsch „Kutsche“; und so verwundert es auch nicht, dass als Logo eine Kutsche fungiert. Bereits das erste „Kleincoche“-Modell sorgte für eine Überraschung, handelte es sich doch hierbei nicht wieder um eine weitere Karosserie-Variante eines 500K oder eines 540K, sondern um die Miniaturisierung des viersitzigen Mercedes-Benz „S“ von 1928 mit einer Karosserie von Buhne, aus Berlin (Bild 1).
 Zum Vorbild sei hier nur erwähnt, dass es irgendwann einmal in den Fünfziger Jahren eine Staren-Rolle in einem Deutschen Spielfilm innehatte (Bild 2). Leider war es mir bislang nicht möglich, weder den Titel des Films, noch den Namen des hier abgebildeten Schauspielers herauszufinden, obwohl ich als erstes dachte, es wäre Goetz George in jungen Jahren. Vielleicht gibt es unter den Lesern einen Sherlock Holmes, der dieses Rätsel lösen kann…
Zum Vorbild sei hier nur erwähnt, dass es irgendwann einmal in den Fünfziger Jahren eine Staren-Rolle in einem Deutschen Spielfilm innehatte (Bild 2). Leider war es mir bislang nicht möglich, weder den Titel des Films, noch den Namen des hier abgebildeten Schauspielers herauszufinden, obwohl ich als erstes dachte, es wäre Goetz George in jungen Jahren. Vielleicht gibt es unter den Lesern einen Sherlock Holmes, der dieses Rätsel lösen kann…
 Was das Modell betrifft, so wurden insgesamt nur 10 Stück hergestellt, erhältlich mit geschlossenem oder mit offenem Verdeck (Bild 3). Selbst unsere von diesem Modell begeisterten Moskauer Club-Mitglieder konnten nicht alle bedient werden. Bei Meister Golovin, wie er sich gerne nennen lässt, gibt es nämlich – zumindest bis jetzt – niemals eine Zweitauflage. Die Qualität und Akkuratesse des Modells kann sich sehen lassen, auch wenn es nicht ganz an das Niveau eines Pivtorak (EMC) heranreicht, aber welch Kleinhersteller könnte dies zurzeit auch nur annähernd erreichen?
Was das Modell betrifft, so wurden insgesamt nur 10 Stück hergestellt, erhältlich mit geschlossenem oder mit offenem Verdeck (Bild 3). Selbst unsere von diesem Modell begeisterten Moskauer Club-Mitglieder konnten nicht alle bedient werden. Bei Meister Golovin, wie er sich gerne nennen lässt, gibt es nämlich – zumindest bis jetzt – niemals eine Zweitauflage. Die Qualität und Akkuratesse des Modells kann sich sehen lassen, auch wenn es nicht ganz an das Niveau eines Pivtorak (EMC) heranreicht, aber welch Kleinhersteller könnte dies zurzeit auch nur annähernd erreichen?
 Erwähnenswert ist die Detaillierung des Verdeck-Gestänges, das völlig vorbildgerecht und akribisch von Golovin wiedergegeben wurde (Bild 4).
Erwähnenswert ist die Detaillierung des Verdeck-Gestänges, das völlig vorbildgerecht und akribisch von Golovin wiedergegeben wurde (Bild 4).
 Beim zweiten Kleincoche-Modell handelte es sich um das Sport-Cabriolet des Mercedes-Benz 710 SSK, mit Karosserie von Papler in Köln (Bild 5). Auch dieses Modell wurde wieder ein gelungenes Kleinod. Mit dieser 1:43er Miniatur bewies Meister Golovin, dass die Qualität seines ersten Modells kein Zufall war, und dass er durchaus als ein ernstzunehmender Hersteller und Lieferant begeisterter Mercedes-Benz-Modellautosammler gelten kann. Um die Modelle des 710 SSK in der Detaillierung zu verfeinern, liess er die Kleinteile bei Tin Wizard in Deutschland herstellen.
Beim zweiten Kleincoche-Modell handelte es sich um das Sport-Cabriolet des Mercedes-Benz 710 SSK, mit Karosserie von Papler in Köln (Bild 5). Auch dieses Modell wurde wieder ein gelungenes Kleinod. Mit dieser 1:43er Miniatur bewies Meister Golovin, dass die Qualität seines ersten Modells kein Zufall war, und dass er durchaus als ein ernstzunehmender Hersteller und Lieferant begeisterter Mercedes-Benz-Modellautosammler gelten kann. Um die Modelle des 710 SSK in der Detaillierung zu verfeinern, liess er die Kleinteile bei Tin Wizard in Deutschland herstellen.
 Wieder gab es nur eine kleine Produktion, doch diesmal wurden es bereits 25 offene, und 25 geschlossene Modelle (Bild 6). Sämtliche Moskauer Sammler konnten also bedient werden. Problematischer wurde es da für „Ausländer“. Man muss nämlich wissen, dass Herr Golovin, wie jeder, der sich Künstler dünkt, seine Eigenarten um nicht zu sagen seine Schrullen hat. Bei ihm besteht das Problem darin, dass er sein nächstes Projekt nur ganz kurzfristig bekannt gibt, und es kann sein, dass er bereits am darauffolgenden Tag keine Bestellungen mehr entgegennimmt – so wird man schnell „exklusiv“! Die bestellten Modelle produziert er auch alle, aber damit hört es dann auch schon bei ihm auf. Die Besteller müssen, wenn es soweit ist, ihre fertigen Modelle bei ihm in seiner Wohnung abholen, verschicken tut er nichts! Keine Ausnahme!
Wieder gab es nur eine kleine Produktion, doch diesmal wurden es bereits 25 offene, und 25 geschlossene Modelle (Bild 6). Sämtliche Moskauer Sammler konnten also bedient werden. Problematischer wurde es da für „Ausländer“. Man muss nämlich wissen, dass Herr Golovin, wie jeder, der sich Künstler dünkt, seine Eigenarten um nicht zu sagen seine Schrullen hat. Bei ihm besteht das Problem darin, dass er sein nächstes Projekt nur ganz kurzfristig bekannt gibt, und es kann sein, dass er bereits am darauffolgenden Tag keine Bestellungen mehr entgegennimmt – so wird man schnell „exklusiv“! Die bestellten Modelle produziert er auch alle, aber damit hört es dann auch schon bei ihm auf. Die Besteller müssen, wenn es soweit ist, ihre fertigen Modelle bei ihm in seiner Wohnung abholen, verschicken tut er nichts! Keine Ausnahme!
Wer also sein Heim nicht in Moskau oder schlimmer noch, nicht in Russland hat, aber trotzdem ein „Kleincoche“-Mercedes in seine Sammlung einbeziehen möchte, der muss zunächst einmal eine Kontaktperson haben, die ihm umgehend nach Bekanntgabe mitteilt, welches Vorbild der Meister als Nächstes zu miniaturisieren gedenkt. Erfährt der interessierte Sammler dies noch rechtzeitig vor dem „Ausverkauf des Vorverkaufs“ des Modellprojektes, sollte er umgehend und natürlich unbesehen das zukünftige Modell bestellen. Ein Sparschwein sollte aber auch bereits zum Bersten gefüllt sein, denn der – gesalzene – Verkaufspreis wird erst bekannt, wenn die ersten Modelle schon versandfertig sind. Überproduktion und Zweitauflagen gibt es nicht, und Ersatzteile schon mal garnicht.
Wenn man nun mit viel Glück in die Bestellerliste aufgenommen wird, und das heiß ersehnte Modell schließlich nach langen Monaten endlich abholfertig ist, muss es von der bekannten oder wenn nicht anders möglich, von einer anderen, also zweiten, Kontaktperson abgeholt, verpackt, und verschickt werden, nach erfolgter Bezahlung des Gesamtbetrags, versteht sich. Kommt das Modell trotz bester Verpackung doch beim Versand zu Schaden, gibt es, wie schon erwähnt, keine Ersatzteile, und auch keine Reparatur. Unter Umständen ist einiges so gebrochen, dass es beim besten Willen auch vom begabtesten Sammler selbst nicht mehr repariert werden kann. Dann steht man vor einem unbrauchbaren und sehr teuren Haufen Modellauto-Schrott.
Genau dies ist mir passiert. Ich hatte mein Modell schließlich in Einzelteilen vorliegen, mit zum Teil nicht nur abgebrochenen sondern zerbrochenen Kleinteilchen, und stellenweise abgeplatztem Lack. Also schickte ich das Modell an meinen Russischen Kontaktmann in den USA zurück. Das Modell selbst wurde zwar von diesem als nicht mehr reparierbar akzeptiert, aber mein Geld bekam ich trotzdem nicht zurück sondern lediglich einen Kredit. Wochen später erfuhr ich dann, dass das Modell von meinem Amerikanischen Kontakt mehr oder weniger recht zusammengeflickt wurde, und…..doch tatsächlich von ihm, und zwar obendrein noch mit Profit weiterverkauft wurde!!!
 Das dritte Modell aus dem Hause Kleincoche wurde der Mercedes „Labourdette“-Skiff aus dem Jahre 1911. Warum Golovin gerade diesen Wagen in 1:43 umgesetzt hat, ist mir etwas rätselhaft, und lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass es erstens noch kein Modell dieses Wagens in diesem Maßstab gab, und zweitens die Verkleinerung des Wagens eine wahre Herausforderung für unseren Modellbauer dargestellt haben dürfte. Der Mercedes „Labourdette-Skiff“ – gemeint ist nun das Vorbild – ist ein umstrittenes Fahrzeug, das für viel Wirbel sorgte, und nicht ganz zu Unrecht als ein Betrug am Kunden bezeichnet wurde (Bild 7). Freundschaften zerbrachen, der Karosseriebauer wurde in den Bankrott getrieben, Prozesse wurden geführt.
Das dritte Modell aus dem Hause Kleincoche wurde der Mercedes „Labourdette“-Skiff aus dem Jahre 1911. Warum Golovin gerade diesen Wagen in 1:43 umgesetzt hat, ist mir etwas rätselhaft, und lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass es erstens noch kein Modell dieses Wagens in diesem Maßstab gab, und zweitens die Verkleinerung des Wagens eine wahre Herausforderung für unseren Modellbauer dargestellt haben dürfte. Der Mercedes „Labourdette-Skiff“ – gemeint ist nun das Vorbild – ist ein umstrittenes Fahrzeug, das für viel Wirbel sorgte, und nicht ganz zu Unrecht als ein Betrug am Kunden bezeichnet wurde (Bild 7). Freundschaften zerbrachen, der Karosseriebauer wurde in den Bankrott getrieben, Prozesse wurden geführt.
Gut, der Wagen muss schon – ob man’s mag oder nicht – als ein echter Mercedes gelten, denn das Fahrgestell ist tatsächlich ein Mercedes-Chassis mit der Nummer 13504. Was den Aufbau betrifft, das allerdings ist eine ganz andere Geschichte. In seiner Ausgabe vom 27. Oktober 2002 fasste die Zeitung „The Plain Dealer“ aus Cleveland (Ohio, USA) die Geschichte folgendermaßen zusammen: „B. Scott Isquick wollte einen Traumwagen sein Eigen nennen. Dale Adams und sein Team hatten das Know-how um ihn zu bauen, doch der Preis war mehr als alle Beteiligten es sich jemals hätten vorstellen können.“
Mister Isquick, das ist erwiesen, und somit kann ich dies hier auch getrost schreiben, ist ein Vorgaukler falscher Tatsachen, ein Möchtegern, ein Hochstapler und ein Gernegroß. Das fängt schon mit falschen Angaben über sein Geburtsdatum und -ort an, und geht mit seinen nachprüfbar erfundenen Heldentaten im Zweiten Weltkrieg als angeblicher Kampfpilot der US-Navy – was er nie war – weiter, bis hin bei festlichen Anlässen zu seinem unbefugten Tragen der Galauniform eines Korvettenkapitäns – einen Rang, den er ebenfalls nie inne hatte. Inzwischen musste allerdings auch er öffentlich gestehen, dass alles von A bis Z nur Lug und Betrug war, wollte er doch stets und immer ein „wichtiger und bedeutender Mann“ sein.
Sein Bedürfnis eine wichtige Person zu sein, führte dann auch zur „Schöpfung“ eines Wagens, der als solcher nie existierte, namentlich des 37/90PS Mercedes, Baujahr 1911, ausgestattet mit einem Skiff-Aufbau von Labourdette. („Skiff“ – das Wort stammt übrigens aus dem Altenglischen, bzw. dem Althochdeutschem Wort „scip“ – vergleiche mit dem heutigem „Schiff“ – und bezeichnet ein kleines Ruderboot, oder auch ein kleines Segelboot, das meistens für eine einzige, höchstens für zwei Personen ausgelegt ist.)
Laut Mr. Isquick’s Angaben – das einzig „Wahre“ an ihm ist, dass er (dank seines Vaters‘ Geldes) tatsächlich Millionär ist – kaufte er in den 70er Jahren von G. Henry Stetson’s Erben (dem Sohn von John B. Stetson, dem Erfinder des bekannten breitkrempigen Stetson-Huts) das Fahrgestell eines 37/90PS Mercedes, Baujahr 1911, mit einem Skiff-Aufbau von Labourdette, Paris, das angeblich 1922 verunglückte, und dessen Aufbau dabei zerstört wurde. Es sei, so seine Behauptung, das einzige Beispiel eines Labourdette-Skiffs auf einem Mercedes-Fahrgestell gewesen.
 Nur gibt es leider keinerlei zeitgenössischen Aufnahmen eines solchen Fahrzeugs, wohl aber eine von G. Henry Stetson am Steuer seines mit einer stinknormalen (Pardon!) Karosserie aus Stahlblech ausgestatteten 37/90PS Mercedes. (Bild 8)
Nur gibt es leider keinerlei zeitgenössischen Aufnahmen eines solchen Fahrzeugs, wohl aber eine von G. Henry Stetson am Steuer seines mit einer stinknormalen (Pardon!) Karosserie aus Stahlblech ausgestatteten 37/90PS Mercedes. (Bild 8)
 In den neunziger Jahren beauftragt Isquick dann Dale Adams Enterprises mit der Restaurierung des sich in einem miserablen Zustand befindlichen Chassis (Bild 9), und der „Restaurierung“ eines Aufbaus, den niemand jemals gesehen hatte, und für den es Unterlagen weder gab, noch gibt.
In den neunziger Jahren beauftragt Isquick dann Dale Adams Enterprises mit der Restaurierung des sich in einem miserablen Zustand befindlichen Chassis (Bild 9), und der „Restaurierung“ eines Aufbaus, den niemand jemals gesehen hatte, und für den es Unterlagen weder gab, noch gibt.
 Dale Adams beschafft sich daraufhin sofort Bücher über Labourdette und sein Schaffen, und findet, fotografiert, und vermisst mit seinem Team einen Peugeot von 1914 mit einem echten Labourdette Skiff-Aufbau, der sich in einem Museum in Seal Cove im Staate Maine (USA) befindet. Was Adams und sein Team dort zu sehen bekommen, imponiert ihnen garnicht. Der Peugeot sieht enorm und sperrig aus. „Das Ding sieht wie eine Lokomotive aus!“, meint ein Mitglied des Adams-Teams (Bild 10).
Dale Adams beschafft sich daraufhin sofort Bücher über Labourdette und sein Schaffen, und findet, fotografiert, und vermisst mit seinem Team einen Peugeot von 1914 mit einem echten Labourdette Skiff-Aufbau, der sich in einem Museum in Seal Cove im Staate Maine (USA) befindet. Was Adams und sein Team dort zu sehen bekommen, imponiert ihnen garnicht. Der Peugeot sieht enorm und sperrig aus. „Das Ding sieht wie eine Lokomotive aus!“, meint ein Mitglied des Adams-Teams (Bild 10).
 Also wird ein Karosserie-Entwurf im Stile von Labourdette zu Papier gebracht (Bild 11) und ein Gipsmodell des Aufbaus hergestellt, das aber aerodynamischer und schicker aussehen soll, und auch aussieht, als der Peugeot-Skiff es ist.
Also wird ein Karosserie-Entwurf im Stile von Labourdette zu Papier gebracht (Bild 11) und ein Gipsmodell des Aufbaus hergestellt, das aber aerodynamischer und schicker aussehen soll, und auch aussieht, als der Peugeot-Skiff es ist.
 Unter ständigem Druck seitens Isquick wird das Fahrzeug schliesslich nach 4 Jahren und insgesamt 12.700 Stunden Arbeit noch knapp rechtzeitig zum „Meadowbrooks Concours d’Élégance 1994“ fertig, und als krönender Abschluss, als i-Tüpfelchen, bekommt der Wagen eine Messing-Plakette aufgeschraubt, mit der eingravierten Unterschrift des Karosseriebauers Labourdette, abgepaust von der authentischen Plakette des in Seal Cove ausgestellten echten Peugeot-Skiff (Bild12).
Unter ständigem Druck seitens Isquick wird das Fahrzeug schliesslich nach 4 Jahren und insgesamt 12.700 Stunden Arbeit noch knapp rechtzeitig zum „Meadowbrooks Concours d’Élégance 1994“ fertig, und als krönender Abschluss, als i-Tüpfelchen, bekommt der Wagen eine Messing-Plakette aufgeschraubt, mit der eingravierten Unterschrift des Karosseriebauers Labourdette, abgepaust von der authentischen Plakette des in Seal Cove ausgestellten echten Peugeot-Skiff (Bild12).
Als Isquick den Wagen in Empfang nimmt, meint er zu Dale Adams: „Der Wagen sieht so gut aus, man könnte ihn als Original ausgeben, niemand würde etwas merken.“ Auf Anhieb wird der Wagen dann auch von Experten mit 1Million US Dollar bewertet. Als Nächstes wird der „Labourdette-Skiff“ dann in Pebble Beach gezeigt. Auf die entsprechende Frage im Teilnahme-Formular wird von Isquick ausgefüllt, dass der Hersteller des Aufbaus Labourdette sei, und auf die weitere Frage, ob es sich um den Originalaufbau handele, wurde von ihm „yes“ eingetragen.
Der Wagen bekommt daraufhin 1994 in Pebble Beach den Preis des „Most Exciting Car“, zu Deutsch des „aufregendsten Wagens“ der Show. Weiter gewinnt der Labourdette-Skiff im gleichen Jahr den Preis der “Professionellsten Restaurierung des Jahres“ vom „Veteranen Automobilklub von Amerika“, und die Auszeichnung „Hervorragende Restaurierung eines Automobils von vor 1921“, vergeben vom „Antiken Automobil Club von Amerika“. Dann geht’s ab nach Europa, wo der Wagen in Paris und Essen ausgestellt und bewundert wird, sogar von Mercedes-Benz gibt es Lob ob der „zeitlosen Schönheit und klassischen Eleganz“ des Wagens, und prompt wird der Wagen von Stuttgart mit einem Preis ausgezeichnet.
 Und es geht weiter mit den Lorbeeren: 2001 erneut in Meadowbrook, 2002 in Detroit. Zwischenzeitlich kommt Franklin Mint zum Millennium in 2000 mit einem Modell des Fahrzeugs im Maßstab 1:24 heraus (Bild13). Der Skiff wird in Franklin Mint’s Katalog als „legendäres Luxusautomobil“ bezeichnet, die Scheinwerfer des Modells werden sogar mit 24-karätigem Gold plattiert, und angeboten wird das Modell für US$ 175.- Zwischen Isquick und Adams, und zwischen Isquick und seinem Anwalt kommt es allerdings zu Prozessen, u.a. wegen übler Verleumdung.
Und es geht weiter mit den Lorbeeren: 2001 erneut in Meadowbrook, 2002 in Detroit. Zwischenzeitlich kommt Franklin Mint zum Millennium in 2000 mit einem Modell des Fahrzeugs im Maßstab 1:24 heraus (Bild13). Der Skiff wird in Franklin Mint’s Katalog als „legendäres Luxusautomobil“ bezeichnet, die Scheinwerfer des Modells werden sogar mit 24-karätigem Gold plattiert, und angeboten wird das Modell für US$ 175.- Zwischen Isquick und Adams, und zwischen Isquick und seinem Anwalt kommt es allerdings zu Prozessen, u.a. wegen übler Verleumdung.
Über die Einzelheiten der Prozesse, und über deren Folgen möchte ich hier nicht im Einzelnen weiter eingehen, es würde den Rahmen dieses Heftes sprengen. Es sei nur erwähnt, dass Adams zwar seinen Prozess gewann, aber auf Grund der von Isquick verbreiteten Lügen und Verleumdungen erst seine Kundschaft und dann sein Karosserie-Atelier verlor, und alle seine Angestellten entlassen musste. Schließlich beauftragt Isquick 2006 ein Auktionshaus den Wagen zu verkaufen. Angepriesen wird das Fahrzeug im Auktionskatalog als ein „Mercedes 37/90PS, Labourdette Skiff, Baujahr 1911“, dessen Fahrgestell vom Werk direkt nach Paris an das Atelier Labourdette ausgeliefert worden sei, und dort seinen Aufbau bekam…..Preisvorstellung: US$ 2.250.000.
Doch es kommt diesmal anders: ein Mr. John Olson und eine Gruppe von ugf. 40 bis 50 Sammlern kontaktiert das Auktionshaus, und sie teilen der Firma mit, dass das angepriesene Fahrzeug nicht das ist, für das es ausgegeben wird. Infolgedessen wird die Beschreibung des Katalogs vom Auktionshaus revidiert. Die neue Beschreibung wurde zu einem Meisterwerk juristischen Geschwafels, sie liess sich über Labourdette und die Bedeutung seines Wirkens aus, stellte jedoch vorsichtigerweise keinerlei Verbindung zwischen ihm und dem angebotenen Mercedes her.
Am Tag der Auktion fuhr Isquick theatralisch mit dem Skiff auf die Bühne vor. Der Auktionator erbat ein Mindestangebot von zwei Millionen Dollars, aber das erste Angebot kam erst, als nur noch 500.000 Dollar verlangt wurden. Lediglich zwei Bieter waren interessiert, schliesslich ging der Wagen für nur knappe $ 925.000 an seinen neuen Eigentümer über. Wäre der Wagen ein echter – wenn auch ein restaurierter – Labourdette-Skiff gewesen, hätte sein Wert laut einiger Spezialisten der Materie ohne weiteres bei 3 Millionen US-Dollar gelegen. Das letzte Wort musste allerdings wieder Isquick haben, meinte er doch, dass es seines Erachtens völlig gleichgültig sei, wie der Wagen denn entstanden sei: „Es ist ein Kunstwerk, und wird für immer als der „Isquick-Skiff“ bekannt bleiben!“
 Und nun zum Kleincoche-Modell dieses Fahrzeugs. Es macht, eigentlich wie das Vorbild, einen arg wuchtigen Eindruck (Bilder 14), und man hat etwas Mühe zu glauben, dass es sich tatsächlich wirklich um ein Modell im Maßstab 1:43 handelt, insbesondere wenn man das Modell neben anderen 1:43 Modellen zeitgenössischer Mercedes-Vorbilder stellt. Bis ins kleinste Detail ist bei diesem äußerst attraktiven Modell alles, einschließlich der Instrumente, akkurat wiedergegeben. Der Lack ist überall am Modell unglaublich sauber aufgetragen worden. Einfach faszinierend, die die Holzmaserung des „Boot-Teils“ darstellende Lackierungsarbeit. Zwar fehlen die 2700 Nieten, die das Vorbild (übrigens zu rein kosmetischen Zwecken) aufweist, aber dieses eine Manko zumindest darf man übersehen, denn eine Wiedergabe der Nieten in 1:43 wäre bei einem handgemachten Modell maßstabgerecht kaum denkbar, und wenn schon, dann könnte man sie sowieso kaum erspähen…
Und nun zum Kleincoche-Modell dieses Fahrzeugs. Es macht, eigentlich wie das Vorbild, einen arg wuchtigen Eindruck (Bilder 14), und man hat etwas Mühe zu glauben, dass es sich tatsächlich wirklich um ein Modell im Maßstab 1:43 handelt, insbesondere wenn man das Modell neben anderen 1:43 Modellen zeitgenössischer Mercedes-Vorbilder stellt. Bis ins kleinste Detail ist bei diesem äußerst attraktiven Modell alles, einschließlich der Instrumente, akkurat wiedergegeben. Der Lack ist überall am Modell unglaublich sauber aufgetragen worden. Einfach faszinierend, die die Holzmaserung des „Boot-Teils“ darstellende Lackierungsarbeit. Zwar fehlen die 2700 Nieten, die das Vorbild (übrigens zu rein kosmetischen Zwecken) aufweist, aber dieses eine Manko zumindest darf man übersehen, denn eine Wiedergabe der Nieten in 1:43 wäre bei einem handgemachten Modell maßstabgerecht kaum denkbar, und wenn schon, dann könnte man sie sowieso kaum erspähen…
 Die Messingteile des Vorbilds, inklusive der mächtigen Imitations Karbid-Scheinwerfer, sehen beim Modell fast so aus, als ob sie mit Blattgold plattiert worden wären. Zweifellos dürfte dieses Modell in einer jeden Sammlung den Blick sofort auf sich ziehen, einerseits schon allein durch seine massive, andererseits durch seine außergewöhnlich luxuriöse Erscheinung. (Bild 16) Nun, Meister Golovin mag durchaus ein begnadeter Künstler sein, ein Techniker ist er allerdings nicht. Damit meine ich, dass er, insoweit ich das überblicke, nicht durchdenkt, wie die Einzelteile stabil – und ich betone dieses letzte Wort – miteinander verbunden werden können, vor allem dort, wo man es beim fertigen Modell nicht sehen kann. Manchmal ist ein dünner Draht eben nur ein zu dünner Draht, und dann sollte doch möglichst ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen zierlich einerseits und haltbar andererseits. So zum Beispiel bei der Halterung der Bremslichter, die, wie nicht anders zu erwarten, beide beim Versand abbrachen, denn diese „rückwärtigen Warnlaternen“ sind auch in 1:43 etwas zu schwer für einen fast haarfeinen Draht, und vertragen kein beim Versand übliches Rütteln und Schütteln.
Die Messingteile des Vorbilds, inklusive der mächtigen Imitations Karbid-Scheinwerfer, sehen beim Modell fast so aus, als ob sie mit Blattgold plattiert worden wären. Zweifellos dürfte dieses Modell in einer jeden Sammlung den Blick sofort auf sich ziehen, einerseits schon allein durch seine massive, andererseits durch seine außergewöhnlich luxuriöse Erscheinung. (Bild 16) Nun, Meister Golovin mag durchaus ein begnadeter Künstler sein, ein Techniker ist er allerdings nicht. Damit meine ich, dass er, insoweit ich das überblicke, nicht durchdenkt, wie die Einzelteile stabil – und ich betone dieses letzte Wort – miteinander verbunden werden können, vor allem dort, wo man es beim fertigen Modell nicht sehen kann. Manchmal ist ein dünner Draht eben nur ein zu dünner Draht, und dann sollte doch möglichst ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen zierlich einerseits und haltbar andererseits. So zum Beispiel bei der Halterung der Bremslichter, die, wie nicht anders zu erwarten, beide beim Versand abbrachen, denn diese „rückwärtigen Warnlaternen“ sind auch in 1:43 etwas zu schwer für einen fast haarfeinen Draht, und vertragen kein beim Versand übliches Rütteln und Schütteln.
 Ditto rissen die Hinterräder mitsamt dem jeweiligen verdeckten Kettenantrieb ab, und warum? Weil der Durchmesser des Zapfens, der dieses Teil mit dem Modell-Körper verbindet, viel zu gering (ca.1mm), und mit knappen 2mm Länge auch viel zu kurz ist. Soweit ich das beurteilen kann, ist dieser Zapfen zudem Bestandteil des Gussteils des Kettenantriebs, kann also nicht einfach durch einen anderen Zapfen ausgetauscht werden. Ankleben kann man beide Teile schon, aber man bekommt die Räder leider nicht wieder ganz senkrecht hin, allein schon wegen dem Gewicht des Modells, denn es gibt keine durchgehende Achse. Hier hätte zwecks Stabilität der „Verbindungsbolzen“ ohne weiteres 2 mm Durchmesser und 5 mm Länge haben können, zumal nach dem Zusammenbau niemand diesen Zapfen bzw. Bolzen erahnen kann, und das hätte auch gehalten! Ich habe anderweitig auch noch von einem anderen Sammler unseres Clubs Bilder von abgebrochenen Rädern, und sogar eines Kotflügels, gesehen (Bild 17).
Ditto rissen die Hinterräder mitsamt dem jeweiligen verdeckten Kettenantrieb ab, und warum? Weil der Durchmesser des Zapfens, der dieses Teil mit dem Modell-Körper verbindet, viel zu gering (ca.1mm), und mit knappen 2mm Länge auch viel zu kurz ist. Soweit ich das beurteilen kann, ist dieser Zapfen zudem Bestandteil des Gussteils des Kettenantriebs, kann also nicht einfach durch einen anderen Zapfen ausgetauscht werden. Ankleben kann man beide Teile schon, aber man bekommt die Räder leider nicht wieder ganz senkrecht hin, allein schon wegen dem Gewicht des Modells, denn es gibt keine durchgehende Achse. Hier hätte zwecks Stabilität der „Verbindungsbolzen“ ohne weiteres 2 mm Durchmesser und 5 mm Länge haben können, zumal nach dem Zusammenbau niemand diesen Zapfen bzw. Bolzen erahnen kann, und das hätte auch gehalten! Ich habe anderweitig auch noch von einem anderen Sammler unseres Clubs Bilder von abgebrochenen Rädern, und sogar eines Kotflügels, gesehen (Bild 17).
Ganz abgesehen von den „bautechnischen“ Schwächen sind die Modelle von Kleincoche ausserdem nur mit einer, ja, nur mit einer einzigen Schraube am Vitrinenboden festgeschraubt, also können sich die Modelle beim kleinsten bzw. kürzesten Versand sozusagen freivibrieren, und bei jeder Bewegung an die Wände der Acrylbox anschlagen, natürlich mit fatalen Folgen, und da sie es können, tun sie es auch! Man sollte von Modellen dieser Preisklasse als selbstverständlich erwarten dürfen, dass sie mit zwei Schrauben befestigt werden. Ich habe ein vergleichbar viel viel billigeres Modell eines ganz banalen Unimogs aus China vorliegen, das sogar mit 3 Schrauben befestigt wurde!

 Vielleicht liegt in der Bruchgefahr die Antwort auf die Frage, warum der Meister seine Modelle ausschließlich bei sich zu Hause abholen lässt… Auch wenn seine Modelle unter den erstklassigen einzureihen sind, kann man nur hoffen, dass Meister Golovin bei jedem Modell noch etwas hinzulernt, denn die Perfektion eines Pivtorak bzw. EMC hat er noch nicht erreicht. Zurzeit arbeitet er unter anderem an einem 1:43 Modell des Mercedes-Benz 630K mit Aufbau von Saoutchick, in verschiedenen Ausführungen (Bilder 18 u. 18A). Und genau 50 Stück insgesamt werden auch von diesem nur produziert werden, hoffentlich mit zwei Befestigungsschrauben…was allerdings leider zu bezweifeln ist, schließlich kenne ich meine Artisten und ihre Sturheit!!
Vielleicht liegt in der Bruchgefahr die Antwort auf die Frage, warum der Meister seine Modelle ausschließlich bei sich zu Hause abholen lässt… Auch wenn seine Modelle unter den erstklassigen einzureihen sind, kann man nur hoffen, dass Meister Golovin bei jedem Modell noch etwas hinzulernt, denn die Perfektion eines Pivtorak bzw. EMC hat er noch nicht erreicht. Zurzeit arbeitet er unter anderem an einem 1:43 Modell des Mercedes-Benz 630K mit Aufbau von Saoutchick, in verschiedenen Ausführungen (Bilder 18 u. 18A). Und genau 50 Stück insgesamt werden auch von diesem nur produziert werden, hoffentlich mit zwei Befestigungsschrauben…was allerdings leider zu bezweifeln ist, schließlich kenne ich meine Artisten und ihre Sturheit!!
Bilder: verschiedene Quellen