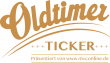Mercedes, Montmartre, Musik, und mehr.
Die kurze Geschichte einer Epoche
Vorwort
Ilario hat jetzt einen höchst interessanten Mercedes-Benz 540K aus dem Jahr 1936 als 1:43 Miniatur herausgebracht, wieder einmal ein exquisites Modellauto, das seinen Platz in jeder guten Mercedes-Benz Modellautosammlung begehrt.
Sein Vorbild ist nicht nur deswegen von Interesse, weil der Wagen ein seltenes Cabriolet A aus dem Jahr 1936 zwar mit 540K Motor, aber noch mit 500K Aufbau gebaut wurde, ein sogenanntes Übergangs- bzw. Vorserien-Modell, von dem nur 13 Exemplaren hergestellt wurden, sondern auch ganz besonders wegen seiner Geschichte, und die Epoche, die er in seinem Pariser „zuhause“ erlebte.
Um die Geschichte, die Eigentümer, und den Werdegang des Cabrios in seiner Heimat Pigalle, dieses für seine vielen Sexshops, Kinos, Cabarets, Erotikshows und kleinen Hotels bekannte Touristenviertel am Fuß des
Montmartre mit seiner Sacré-Coeur Basilika richtig zu verstehen, muss man bis ins frühe XIX. Jahrhundert zurückgehen.
Paris – Montmartre 1845
Bevor ich aber in diese Geschichte eintauche, sollte noch kurz erwähnt werden, dass der Mercedes 500K/540K mit Fahrgestell und Motor-Nummer 130946 (Kommissionsnummer „226106“) am 3. Juni 1936 bestellt, und seine Karosserie am 13. Juli desselben Jahres im Werk Sindelfingen fertiggestellt wurde.
 Der Wagen wurde am 12. Oktober 1936 von seinem ersten Eigentümer im Mercedes-Benz „Atelier Vautrin“-
Der Wagen wurde am 12. Oktober 1936 von seinem ersten Eigentümer im Mercedes-Benz „Atelier Vautrin“-
Showroom an den Champs-Elysées in Paris abgeholt. Der Wagen wurde von der Besitzerin des bekannt-berüchtigten Pariser Cabarets bzw. des „Bar Américain La Roulotte“, einer Frau Lucy Franchi, bestellt, die,
wie es heißt, ihrem Bruder, der mit ihr den Nachtklub leitete, das Cabriolet A umgehend schenkte.
„Bar Americain“ ist übrigens eine Bezeichnung, auf die man heutzutage, wenn überhaupt, nur selten stößt, die jedoch in den neunzehnhundert-zwanziger und -dreißiger Jahren in Frankreich eine Bar bezeichnete, die nebst anderen alkoholischen Getränken auch Cocktails zubereitete und servierte, zu der Zeit in Europa anscheinend noch ungewöhnlich, aber in Mode, heute gang und gäbe.
Doch nun zu der Geschichte vom Montmartre – und Pigalle – aus den Anfangsjahren des XIX. Jahrhunderts
bis in die heutigen Tage.
Der Alltag in Paris 1834
Das Paris von 1834 war noch von circa 24 Kilometer Stadtmauern umgeben, durchbrochen von 55 Stadttoren. Diese Mauern und Tore waren, laut damaligen bösen Zungen, nicht von Ingenieuren erbaut worden, um die städtischen Grenzen zu bestimmen, es schien eher, dass sie ausschließlich zum Einnehmen von Zöllen bestimmt waren, nach dem Motto „Gratis ist bis hierher, und keinen Schritt weiter!“. Und so war es letztendlich auch!
Tatsächlich wurden seit dem noch kurz vor der französischen Revolution 1789 fertiggestellten Bau der drei Meter hohen Steinmauer sämtliche Waren und Lebensmittel beim Eingang in das Pariser Stadtgebiet mit Einfuhrzöllen
belegt, die wie immer den ärmeren Schichten der Gesellschaft am meisten schadeten. Da alle Bedarfsartikel und Nahrungsmittel jenseits der Stadttore wesentlich billiger waren, zogen viele einkommensschwache Haushalte, gezwungen, mit jedem Pfennig zu rechnen, in die vorstädtischen Dörfern vor den Toren. Dank der Nähe konnten sie jedoch innerhalb von 5 Minuten wieder zu Parisern werden, so als ob sie nie weggezogen wären. Und mit Vorstadt war nur die erste Viertelmeile vor den Toren gemeint, danach war dann schon Landgebiet und innerhalb dieser kurzen Entfernung entwickelten sich seltsamerweise schon Gewohnheiten, die sich überraschend von dem Charakter und den Gewohnheiten von Paris abhoben.
Das Treiben an den Toren konnte in zwei Abschnitte geteilt werden: ab sechs Uhr morgens im Sommer, und bei Sonnenaufgang im Winter. Da wimmelte es bei den Weinhändlern nur so von Arbeitern auf dem Weg nach Paris, die schnell noch auf dem Weg zur Arbeit ihre „Kanone“ (umgerechnet circa ein Viertelliter) Wein tranken, auch waren einige Einwohner der Nachbarschaft darunter, dazu gesellten sich zahlreiche Gemüsebauern, die ihren frisch gepflückten Salat und ihr Gemüse anboten. Gegen neun Uhr morgens war dann das Frühstück in den Gaststätten erhältlich, durchwegs eine in einem enormen Teller servierte gute Suppe. Am Rochechouart Tor war dank der nahegelegenen Schlachthöfe stets mit einem guten Stück Fleisch in der Suppe zu rechnen. Der Preis einer solchen Suppe belief sich auf 3 „Sous“ bzw. 15pfg. und es gab einen freien Nachschlag. Die Kunden dieser Gasthöfe waren hauptsächlich Bauarbeiter, Verputzer und Zimmerleute auf dem Weg zur Arbeit in die stetig wachsende Stadt, und Schlachthofarbeiter der großen Schlachthöfe vor Montmartre.
Der zweite Tagesabschnitt, an dem es an den Toren hoch herging, war um die Mittagszeit gegen zwei Uhr. Dann kamen viele der Arbeiter zur Mittagsmahlzeit zurück in ihr Stammlokal. Eine Suppe konnte man um diese Zeit nicht mehr finden, dafür gab es aber Kalbs- oder Hammelragout à 4 Sous (20 Pfg.) den Teller. Abends wurde dann zu Hause gegessen. Im Laufe des Vormittags verließen umgekehrt viele pariser Hausfrauen kurz die Stadt für einen schnellen Einkauf vor den Toren und kamen mit einem Humpen Rotwein zurück. Die gleichen Frauen gingen abends nochmals außerhalb der Tore einen weiteren Humpen Rotwein kaufen. Dieser zweimalige Einkaufsbummel war notwendig, weil jeweils nur ein Humpen zollfrei in die Stadt erlaubt wurde.
Mit zwei Humpen Wein zum Abendbrot musste aber schon gerechnet werden, und da bedeutete der kurze Weg aus der Stadt hinaus immerhin eine Ersparnis von 5 sous pro Tag (25 Pfg.) für eine Familie, die jeden Pfennig
zweimal umdrehen musste, schon ein nettes Sümmchen… bedenkt man, dass allein ein zollfreier Humpen schon 12 Sous (60 Pfg.) kostete.
Paris am Wochenende
So geschäftig, laut und hektisch wie es tagsüber an den Toren zuging, so ruhig war es abends…außer an Sonntagen und Montagen.
1865 beschrieb der französische Zeitzeuge und Chroniker Alfred Delvau in seinem Buch über das Leben und Treiben an den Stadttoren: „Von Mittag bis Mitternacht herrscht an den Toren ein Drängen, um aus dem Grauen der Stadt ins Grüne der Vorstädte zu gelangen. Dort findet das Volk Entspannung, Vergnügen, Glück. Da geht das Ersparte drauf, ohne Gedanken an die Zukunft. Die Gegenwart wäre auch unerträglich, könnte man am Wochenende nicht in seine Stammwirtschaft einkehren. Es gibt faule Handwerker, die an den ersten vier Wochentagen nichts oder fast nichts tun, an den letzten zwei Arbeitstagen dann eifrig schuften, nur um genügend Geld zusammen zu bekommen, damit der Sonntag jenseits der Stadtmauer verbracht werden kann, den Durst nach Wein und Vergnügung stillend.
Es ist schwer nachzurechnen, wieviel das den Geschäften einbringt. Nachweislich verkaufen zur schönen Jahreszeit so manche „cabarets“, am Sonntag dreitausend sechshundert Liter, sprich viertausend acht hundert
Flaschen Wein. Gegessen wird fast genauso viel: an einem einzigen Tag werden 10 bis 12 Kälber verzehrt, hinzu kommt Gemüse und Salat. Es ist erschreckend!
Man verrechnet sich tatsächlich nicht arg, behauptet man, dass innerhalb der Stadt in der Woche zehnmal weniger Wein verkauft wird, als außerhalb am Sonntag.“
Allerdings geht man sonntags nicht nur zum Speisen und Trinken aus: was wirklich die Menschen am meisten anzieht, das sind die Tanzböden. Es gibt kein Tor aus der Stadt, wo es nicht auf der anderen Seite 5 oder 6 Bälle
gäbe: es wird in den Gärten, in Sälen, in Höfen, und sogar in den Gaststätten selbst getanzt. Jeder Ball hat seinen eigenen Charakter. Jeder Ball wird auch von zumindest einem oder zwei wie es heißt, durchwegs gutmütigen, Polizisten bewacht. Sie sind die „Beschützer von Anstand und guten Sitten.“ Bei Verstoß wird der Säbel gezogen, nicht etwa zur Benutzung: das Glänzen der Klinge allein bringt schon wieder Ordnung in den Saal!
Eine des bekanntesten Ball-Adressen war in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts der für Liebhaber von Impressionisten heute noch bestens bekannte „Moulin de la Galette“, die „Pfannenkuchen Mühle“, auf dem Montmartre, deren Treiben auf der Tanzfläche im Garten der Maler Pierre-Auguste Renoir 1876 so wunderbar treffend auf Leinwand verewigte. Dieser „Moulin de la Galette“ ist eins der besten Beispiele des Wandels von
Montmartre. Ursprünglich, ab 1100, war der Gipfel des 130 m hohen Hügels von einer kleinen Ortschaft besiedelt, die sich um eine Benediktiner-Abtei drängte, und die bevorzugteste Windmühlen-Lage in der Nähe von Paris zum Mahlen der Getreide aus den Feldern der Umgebung.
Heute geht man davon aus, dass die ersten Mühlen dort bereits im XI. Jahrhundert ihr Mehl nach Paris lieferten. Ende des XVIII Jh. gab es insgesamt 25 Windmühlen auf all den Hügeln im Norden von Paris, davon allein 13 auf dem Montmartre, von denen zumindest acht noch in Betrieb waren.
Anfang des XIX. Jahrhunderts begriffen die Müller, dass es viel profitabler für sie war, zusätzlich zum Getreidemahlen am Fuße der Mühle noch ein kleines Gartenlokal zu betreiben. Nach ihren langen Ausflügen waren die Sonntagsspaziergänger aus Paris müde, durstig und hungrig. Da bot sich eine zusätzliche Einkommensquelle von selbst an, frisch gebackenes Brot, frisch gebackene Milchbrötchen, und auch kleine Mahlzeiten wie die „Galettes“ also Pfannkuchen, und Getränke anzubieten. Schließlich bearbeitete jeder Müller noch, wenn schon nicht ein ganzes Feld am Fuße des Montmartre, dann doch zumindest einen Schrebergarten, mit Gemüseanbau, Hühner für die Eier, und hatte oftmals sogar ein paar Kühe für Milch und Käse.
 An Getränken konnte man frisches Wasser von dem Montmartre-Brunnen, Milch, und ab 1830 Weißwein von den am Montmartre wachsenden Reben bekommen. Ob der Montmartre Wein gut war, darüber gab damals ein Mr. Charles Sellier die Auskunft, dass der Wein Anfangs des XIX. Jh., als „très mauvais“, also als sehr schlecht galt. Heutzutage erbringt die jährliche Lese immerhin genügend für ca. 1500 Flaschen „Clos Montmartre“. Die heutige Qualität ist dank engagierter Pflege und Liebe zur Sache über die Jahrzehnte besser geworden, nach eigener Angabe der Winzerin Sylvie Leplatre „wird der Wein auf jeden Fall Jahr für Jahr besser“. Mit 50€ die halbe Flasche nicht gerade billig, ist er jedoch wohl mehr als Souvenir zum hinstellen, als zum genießen gedacht. Der Erlös trägt zur Unterstützung einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation für ältere Künstler bei, und zur Erhaltung und Pflege des Weinbergs mit seinen 1700 Rebstöcken.
An Getränken konnte man frisches Wasser von dem Montmartre-Brunnen, Milch, und ab 1830 Weißwein von den am Montmartre wachsenden Reben bekommen. Ob der Montmartre Wein gut war, darüber gab damals ein Mr. Charles Sellier die Auskunft, dass der Wein Anfangs des XIX. Jh., als „très mauvais“, also als sehr schlecht galt. Heutzutage erbringt die jährliche Lese immerhin genügend für ca. 1500 Flaschen „Clos Montmartre“. Die heutige Qualität ist dank engagierter Pflege und Liebe zur Sache über die Jahrzehnte besser geworden, nach eigener Angabe der Winzerin Sylvie Leplatre „wird der Wein auf jeden Fall Jahr für Jahr besser“. Mit 50€ die halbe Flasche nicht gerade billig, ist er jedoch wohl mehr als Souvenir zum hinstellen, als zum genießen gedacht. Der Erlös trägt zur Unterstützung einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation für ältere Künstler bei, und zur Erhaltung und Pflege des Weinbergs mit seinen 1700 Rebstöcken.
Das kleine Gartenrestaurant der „Moulin de la Galette“-Mühle, die nachweislich seit 1635 von der gleichen Debray-Familie betrieben wurde, und eigentlich aus zwei Mühlen bestand: der „Blute-Fin“ (in der damaligen Fachsprache etwa „Fein gesiebtes“), und der „Moulin Radet“-, wurde als Ausflugsziel, nicht zuletzt wegen der beliebten Milchbrötchen und Pfannekuchen immer beliebter. Der Gaststättenbetrieb wurde immer einträglicher, das Getreidemahlen wurde eingestellt, die 1833 eröffnete Tanzdiele wurde zu einem großen Erfolg, und aus der einen Mühle wurde ein Aussichtsturm. Aus dem „Moulin de la Galette“ war ein „Moulin-Cabaret“ geworden, und wurde zum „go to place“.
Renoir, Toulouse-Lautrec, van Gogh, Picasso (die alle dort ein und aus gingen), Kees van Dongen, Utrillo und
noch viele mehr oder weniger bekannte malten diesen “Moulin de la Galette“ aus verschiedenen Blickwinkeln und das oft mehrmals.
 Heutzutage ist der „Moulin de la Galette“, mit dem zwar restaurierten, dennoch authentischen und unter Denkmalschutz stehenden „Moulin Radet“ auf dem Dach, ein erfolgreiches und gutes Restaurant, das typisch
Heutzutage ist der „Moulin de la Galette“, mit dem zwar restaurierten, dennoch authentischen und unter Denkmalschutz stehenden „Moulin Radet“ auf dem Dach, ein erfolgreiches und gutes Restaurant, das typisch
traditionelle französische Küche serviert, und eine traditionelle Atmosphäre bietet.