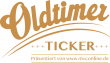Mit diesem Artikel übersendet die ADAC Klassik – Abteilung das Protokoll der Sitzung des Parlamentskreis Automobiles Kulturgut im Deutschen Bundestag (PAK) vom 15. März 2024 mit den Anhängen zu Ihrer Kenntnis. Gerne erhält man bei ADAC Klassik Feedback und Anregungen zu den Themen.
Hinweis: Die Protokolle und Anlagen der bisherigen Sitzungen finden Sie unter: https://www.adac-motorsport.de/parlamentskreis-automobiles-kulturgut

TOP 1 Eröffnung der Sitzung & Begrüßung – Carsten Müller | MdB
Carsten Müller begrüßt die Runde und eröffnet die Sitzung mit dem Verweis auf aktuelle Ausgaben des ADAC-Oldtimerratgebers vor dem Saal. Sollte der Wunsch nach einer höheren Anzahl bestehen sollte, kann Johann König unter johann.koenig@adac.de kontaktiert werden.
TOP 2 eFuel-Update – Ralf Diemer | Geschäftsführer eFuel Alliance e.V.
Ralf Diemer beginnt seine Ausführungen mit der Vorstellung des eFuel Alliance e.V. und verweist auf die erarbeitete Präsentation, die dem Protokoll beiliegt. Sie führt zu zentralen Aspekten aus und enthält die wesentlichen Daten zur Thematik.
Auffällig ist, dass großes Interesse japanischer Unternehmen an einer Mitgliedschaft in der eFuel Alliance besteht, die ursächlich durch die dezidierten eFuel-Strategie der japanischen Regierung zu begründen ist. eFuels werden dort als zentrale Importprodukte definiert, so dass großes Interesse an Thema und Herstellern besteht. Das verdeutlicht, dass ein globaler Wettbewerb besteht.
Anknüpfend an die Ausführungen zur PAK-Sitzung im Juni 2023 betont Ralf Diemer, dass seither auf europäischer Ebene eine Reihe von Entscheidungen gefallen sind. Es fehlen noch Vorschläge oder Regulierungen, zum Einsatz von eFuels in Verbrennern. Obwohl die Überarbeitung der europäischen Richtlinie zur Nutzung Erneuerbarer Energien, RED III, besser als die derzeit geltende RED II ist, wäre hier ein ambitionierter eFuel-Ansatz deutlich wünschenswert gewesen. Wünschenswert wäre es auch, wenn viele bestehende Rechtsunsicherheiten und zu restriktive Maßnahmen in den Delegierten Rechtsakten ausgeräumt würden, denn die Delegierten Rechtsakte sind 1:1 umzusetzen. Unbestimmte Rechtsbegriffe, die nicht final definiert sind, schaffen bei der Umsetzung eine Rechtsunsicherheit, die im Zweifel Investitionen verhindern oder Produkte aus Europa fernhalten.
Ein weiteres Themenfeld ist in diesem Kontext das unausgereifte Zertifizierungssystem der Europäischen Union. Das führt zu Skandalen mit falsch zertifizierten Kraftstoffen, weil etwa einige außereuropäische Hersteller den Zertifizierungsbehörden an den Produktionsstandorten selbst die Einsicht und Kontrolle verweigern und dennoch nach Europa exportieren können. Diese Mängel der Zertifizierung hat direkte wirtschaftliche Folgen für die Hersteller in Europa.
TOP2_240315_eFuel_alliance_20240315
Gefragt wird, ob Nutzfahrzeuge, die mit HVO100 unterwegs sind, einen Mautvorteil bekommen werden. In der Antwort darauf wird bekräftigt, dass sich die Branche dafür und für steuerliche Anreize für den Einsatz fortschrittlicher Biokraftstoffe einsetzt, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Vorteile beschlossen sind. Aber die Branche wird sich weiter dafür einsetzen, denn die Frage kann in Deutschland, aber müsste in Europa geklärt
werden. Carsten Müller bekräftigt, dass die Frage der Brennstoffbesteuerung dringend geklärt werden muss und es schon heute bewährte Rückvergütungsinstrumente oder noch vereinfachter mit einem Digitalen Zwilling. Grundsätzliches Ziel muss es sein, die Nachfrage zu steigern. Vom DEUVET wird betont, dass dort auch der Fokus auf den Einsatz der Kraftstoffe bei historischen Fahrzeugen gelegt wird und skizziert einige bestehende
Problemfelder. Matthias W. Birkwald hebt hervor, dass wir nach 2035 überhaupt die Möglichkeit erhalten könnten, Neufahrzeuge mit klimaneutralen Kraftstoffen zu betreiben, ist dem Einsatz des Bundesverkehrsministers zu verdanken. Anschließend wird von ihm nach dem Stand der angekündigten eFuel-Tankstelle in Berlin sowie nach einem Überblick zur Anzahl von eFuel-Tankstellen in Deutschland. Ralf Diemer betont, dass es Bestrebungen zu dieser Tankstelle in Berlin gab, die wohl aber noch nicht zu einem Ergebnis geführt hätten. Ursächlich dafür sind wahrscheinlich eine Fülle von Problemen – von der Genehmigung über Produktionsmengen usw. Tatsache ist, in allen Bereichen bewegt sich etwas und es lässt sich ein stufenweiser Hochlauf. Dieser wird jedoch nicht dazu führen, dass diese klimaneutralen Kraftstoffe in 2024 an zahlreichen Tankstellen in Deutschland getankt werden können – ausgenommen ist davon die HVO100-Situation, die sich positiver darstellt. Ein Grundproblem wird sein, dass bei den eFuels bis 2030 von deutlich höheren Produktionskosten als bei fossilen Kraftstoffen auszugehen ist. Daher sind die Regulierung, Rechtssicherheit und Vereinfachung so entscheidend. Carsten Müller greift das Thema Tankstelle Berlin auf und berichtet, dass sich die Kooperation zwischen dem Unternehmen und dem Tankstellenbetreiber kurz nach der Ankündigung zerschlagen hat. Zum Thema HVO100 verweist Carsten Müller auf Italien und der breiten Verfügbarkeit an Tankstellen, die dort sogar im Abgabepreis 10 Cent unter fossilem Diesel liegen. Roland Kaiser führt zur Tankstelle in Berlin aus, dass das Unternehmen P1 viele Ankündigungen und Zusagen nicht eingehalten habe. Er bietet darüber hinaus an, dass die Ergebnisse zweier Bachelorarbeiten zu eFuels und HVO100, die gerade finalisiert werden, in einer der Folgesitzungen vorgestellt werden können. In diesen Arbeiten geht es nicht um die Verträglichkeit der synthetischen Kraftstoffe, die ist längst unstrittig, sondern um konkrete Auswirkung, wie etwa auf Leistung, Verbrauch, Geräusch und Abgase. Peter Stein appelliert, dass wir im Bereich der Regulierung mutig vorangehen, an den Industriestandorten möglichst ambitioniert agieren und nicht die verschiedenen
innovativen Produkte gegeneinander ausspielen.
Ralf Diemer führt abschließend aus, dass bei einem Interesse an einen Bezug von eFuel für bestimmte Projekte oder Tests, der eFuel-Alliance e.V. über die Homepage (www.efuel-alliance.eu) kontaktiert werden kann. Diese Anfrage wird automatisch an die produzierenden Mitgliedsunternehmen geleitet, die dann Kontakt aufnehmen und Details besprechen.
TOP 3 Abschaltung der UKW-Frequenzen – Peter Diehl | kfz -betrieb
Peter Diehl berichtet zum Thema „Abschaltung der UKW-Frequenzen“ und deren Auswirkungen auf den Bereich der historischen Fahrzeuge. Die grundlegende Frage wäre: hinnehmen oder widersprechen? Die verwendete Präsentation wird dem Protokoll beigefügt.
TOP3_Abschaltung der UKW-Frequenzen_20240315
Nachdem das Thema allgemein betrachtet und vom Referenten skizziert wurde, werden Pro und Contra einer Abschaltung gegenübergestellt. Für die Abschaltung sprechen die finanziellen Einsparungen der Sender und die Nutzbarkeit der Frequenzen durch andere Anwendungen. Gegen die Abschaltung ist die Tatsache hervorzuheben, dass noch millionenfach UKW-Radiogeräte in Benutzung sind – in Privatwohnungen, in Fahrzeugen usw. Dagegen sprechen ebenfalls die nicht flächendeckende Verfügbarkeit der Digitalstandards DAB und DAB+, oder ein Katastrophenfall und dem dann möglicherweise erforderlichen Rückgriff auf analoge Technik, zumal die Mittelwellen seit 2015 abgeschaltet sind. Im spezifischen Fahrzeugbereich wird DAB+ selbst in modernen Fahrzeugen häufig nur als Sonderausstattung angeboten. Auch wird der Verkehrsfunk über UKW-Frequenzen angeboten.
Im Fahrzeug sind jedoch einige Kompensationsmöglichkeiten verfügbar. So bieten spezialisierte Unternehmen markenspezifische oder markenspezialisierte Retrogeräte, an.
Im PAK zu klärende Fragen, wäre die Positionierung der Szene zur Abschaltung, wobei die Oldtimerszene und ihre Interessen hierbei wahrscheinlich nicht das primäre Problem wären, sondern das Thema Katastrophenschutz einen höheren Stellenwert einnimmt. Solange es keine flächendeckenden Angebote in diesem Bereich geben wird, sieht Sebastian Groehl keine Abschaltungsgefahr. Zum nächsten Jahr wird diese sicherlich nicht umgesetzt. Andreas Keßler unterstützt die Ausführung des Vorredners und geht nicht von der Abschaltung vor dem Jahr 2032 aus, möglicherweise sogar später. Er bietet eine technische Vorführung im PAK-Kreis an, um zu verdeutlichen, dass der Eingriff in historische Radios nicht sehr tief ist oder sein muss, um sie für den digitalen Standard einsatzfähig zu bekommen und das technische Kulturgut zu retten. Das erleichtert die
Diskussion. In einer der nächsten Sitzung wird es zu dieser Vorführung kommen. Matthias W. Birkwald fragt, ob UKW-Radios überhaupt noch in Neuwagen verbaut würden. Das bestätigt die Runde. Darüber hinaus führt er aus, dass in dem aktuellen Finanzbericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), die Mittel für UKW bis ins Jahr 2032, auch wenn die Beträge in diesem Zeitraum abschmelzen, noch enthalten sind.
TOP4_Classic meets Future_20240315
TOP 5 Bestandsprognose historischer Fahrzeuge – Martin Zabel | DEUVET – Dr. Ekkehard Pott | DEUVET
Der Tagesordnungspunkt wird vorgezogen. Martin Zabel und Dr. Ekkehard Pott skizzieren Ergebnisse einer eigenen Studie zum prognostizierten Oldtimerbestand in der Zukunft. Die verwendeten Folien liegen dem Protokoll bei.
TOP5_DEUVET_Oldtimerprognose_20240315
Die Studie beleuchtete die mögliche Entwicklung bis in das Jahr 2040 unter der Berücksichtigung von vier Kernthemen: der Bestandsentwicklung Der Fahrzeuge Ü30 und der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen-Zulassung, der Entwicklung der Fahrleistungen, der CO2-Emissionen sowie der Schadstoffemissionen (der Kohlenwasserstoffe (HC) sowie der Stickstoffe (NOx)). Erkennbar ist der Trend, dass das Fahrzeugalter und die Nutzungsdauer der Fahrzeuge in den letzten Jahren stetig zunehmen. Es wird prognostiziert, dass der Anteil der Fahrzeuge Ü30 im Bestand des Jahres 2024 etwa 5 Prozent betragen wird. Es wird erwartet, dass entsprechend die absolute Zahl der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen steigen wird – auf etwa 3 Prozent des Gesamtbestandes. Wichtig hierbei: Der relative Anteil der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen wird jedoch abnehmen. Die Fahrleistung aller Ü30 Fahrzeuge wird bis 2040 nicht über 0,5 Prozent der Jahresfahrleistung aller Pkw ansteigen. Der CO2 Emissionsanteil aller Ü30 Fahrzeuge wird bis 2040 bei deutlich unter 1 Prozent der gesamten liegen CO2 Emissionen.
Es wird die Fragen nach dem Hintergrund der angenommenen Bestandsdaten gefragt, ob beispielsweise nicht nur die produzierten Stückzahlen, sondern auch der demografische Wandel berücksichtigt wurde. Dr. Ekkehard Pott führt dazu aus. Der demografische Wandel wurde nicht berücksichtigt. Wenn dieser mit in der Studie berücksichtigt würde, ist davon auszugehen, dass die hier präsentierten Zahlen zum Gesamtbestand der Ü30-
Fahrzeuge und der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen im Jahr 2040 mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer sein werden. Die verwendeten Daten basieren im Wesentlichen auf KBA-Daten. Matthias W. Birkwald unterstützt den Ansatz der Analyse auf Basis der Bestandsdaten ausdrücklich. Aus dem Plenum wird betont, dass die Studie
erneut belegt, dass die immer wieder von Gegnern geschürte Angst der „Oldtimerschwemme“ nicht nur ausreichend widerlegt ist, sondern jeder Grundlage entbehrt.
TOP 6 Verschiedenes – Sachstand Kfz-Steuer -H-Kennzeichen – Carsten Müller | MdB
Der Tagesordnungspunkt wird vorgezogen. Carsten Müller berichtet, dass der Bericht des Bundesrechnungshofes zu den H-Kennzeichen bis auf weiteres nicht auf der Tagesordnung des Rechnungsprüfungsausschusses zu finden ist. Mehrere Fraktionen haben Widerspruch signalisiert. Auch wenn die härtesten Kritiker in der jüngsten Vergangenheit deren falsche Argumente nicht wiederholt haben, ist weiterhin Vorsicht geboten. Die Mitglieder des PAK werden entsprechend beobachten und handeln sowie weiter sensibilisieren, sobald es erforderlich wird.
Sachstand_PFAS Überblick März 2024
Bericht Authentizität Nachbau historischer Fahrzeuge – Carsten Müller | MdB
Carsten Müller nimmt Bezug auf die entsprechenden Ausführungen der vergangenen Sitzung. In der einschlägigen Presse tauchen immer wieder einige Verlautbarungen auf. Es ist anzunehmen, dass die Anklageerhebung in Baden-Württemberg bevorsteht. Aktuell hat sich ein Verein gegründet, der die Frage der Authentizität von historischen Fahrzeugen als Vereinsziel hat und sich dabei ausdrücklich nicht auf den Typ W198 beschränken, sondern weiter Fahrzeuge und Hersteller in den Fokus nehmen will.
Mögliche Besichtigung Bio-Raffinerie -Zeitz – Carsten Müller | MdB
Über einen fachkundigen Journalisten wurde das Angebot unterbreitet, die Bio-Raffinerie Zeitz zu besichtigen. Terminvorschläge wurden an den PAK bereits versendet. Carsten Müller bittet um eine Rückmeldung bis zum 22. März an sein Berliner Büro. Der Terminvorschlag mit der höchsten Resonanz würde ausgewählt und bekannt gegeben. Wichtig ist: Die Anreise wird in Eigenregie zu gewährleisten sein. – Im Nachgang der Sitzung ergab sich eine Verschiebung der Besichtigung auf einen Zeitpunkt später im Jahr.
Nachwuchs – Roland Kayser
Roland Kayser führt zum Thema Nachwuchs aus und berichtet aus seinen Erfahrungen. Er hat einen Azubi heute mitgebracht. Christian Bollerhof berichtet von seiner Motivation, sich zum Oldtimermechaniker ausbilden zu lassen. Familiär durch die Oldtimersammlung seines Vaters vorbelastet sowie persönlichen Erfahrungen aus einem dualen Studium „Automobilmanagement“ wurde die Leidenschaft für die Werkstatt erkannt – ganz speziell jedoch für historische Fahrzeuge. Es fällt auf, dass etwa in der Berufsschule, der etwas andere Ansatz und das andere Verständnis zu Fahrzeugen wahrgenommen wird. Roland Kayser ergänzt, dass zum „Mechatroniker“ ausgebildet wird, da es den Ausbildungsberuf des „Oldtimermechaniker“ nicht gibt. Deswegen bieten die IHKs für Auszubildende zusätzliche Lehrgänge an, die besondere Befähigungen, die in Oldtimerwerkstätten durch die alltägliche Arbeit nicht abgedeckt werden können, angeboten werden.
TOP 4 Vorstellung „Classic meets Future“ – Tom Fischer | Initiative “Classic meets Future”
Tom Fischer stellt sich und das von ihm aufgebaute Unternehmen vor. Das Thema Nachwuchs ist seit einigen Jahren sehr präsent, denn seit einigen Jahren wurde immer intensiver festgestellt, dass der aktuelle Ausbildungsberuf des Mechatronikers nicht mehr den Anforderungen der Oldtimerwerkstätten entspricht. Daher wurde vor drei Jahren die Initiative „Classic meets Future“ gestartet. Die genutzte Präsentation erstellte dem
Protokoll bei.
„Classic meets Future“ bildet sich aus einer Gruppe von Unternehmern mit Werkstätten, die an klassischen Fahrzeugen arbeiten, Besitzern von klassischen Fahrzeugen sowie Repräsentanten von Verbänden, die die „Oldtimer-Szene“ unterstützen. Unterstützt wird die Initiative von der Technischen Hochschule Rosenheim. Beim Thema Fachkräftemangel wurden wesentliche Probleme identifiziert: Viele Unternehmer geben altersbedingt ihr Geschäft auf, ohne einen Nachfolger zu haben. Darüber hinaus gehen viele erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand, ohne ihr Wissen an Jüngere weitergeben zu können. Dieser Wissensverlust ist schwer zu kompensieren. Für die Sektor der Oldtimerwerkstätten existiert kein geregeltes oder spezifisches Berufsbild, für das sich interessierte junge Menschen bewerben können. In der Folge fehlen dann wieder Nachfolger als Unternehmer. Diese Entwicklung tritt in einer Phase auf, in der die Anzahl der klassischen Fahrzeuge weiter zunimmt und sich gegenläufig zur Abnahme des Wissens und der Fachkräfte entwickelt.
„Classic meets Future“ ist international vernetzt – Österreich, Belgien, Schweiz, Frankreich, England, auch mit den USA. Unser Ziel ist es, Wege zu entwickeln zu Qualifizierung und neuen motivierten Fachkräften für unsere Werkstätten, deren spezifische Ausbildungsmöglichkeit durch eine Anpassung des Ausbildungsberufs an moderne Gegebenheiten verloren gegangen ist. Die persönlichen Erfahrungen zeigen, dass in unseren Werkstätten attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze angeboten werden können und denen eine hohe Anzahl von motivierten, technikaffinen Interessentinnen und Interessenten demgegenüber stehen.
Aus der PAK-Runde werden vergleichbare Erfahrungen zur Ausbildungssituation geschildert. Es zeigt sich, dass die „Classic meets Future“ eine sehr erfolgreiche und musterhafte Initiative ist, die durch ihre umfassende Komplexität eine sehr geeignete Blaupause in diesem Bereich darstellt. Matthias Kemmer berichtet, dass auf Grundlage des Berufsbildungsgesetz die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer die Berufsbilder entwickeln. In der Regel sind das sehr aufwendige Prozesse, die dann über das Ministerium und die Kultusministerkonferenz abgesegnet wird. In den vergangenen Jahren gab es über den ZDK ein Pilotprojekt eine Zusatzqualifizierung in Oldtimerbereich, die auf freiwilliger Basis angeboten wurde. Über dieses Projekt haben in ganz Deutschland von Aurich bis Bayern 250 junge, motivierte Leute diesen Verbandsabschluss gemacht. Das Projekt wurde richtigerweise durch den Berufsbildungsabschluss eingestellt, da es so nicht umsetzbar war, denn die Absolventin oder der Absolvent kann nicht vom Vorkriegsfahrzeug, über das Motorrad, das Nutzfahrzeug, den Rennsportklassiker bis hin zum Youngtimer alles beherrschen. Die Bandbreite historischer Fahrzeuge ist zu groß. Aber, aus dieser Erkenntnis heraus hat der Berufsbildungsausschuss in Bonn und in Zusammenarbeit mit den Zentralverband Deutsches Handwerk zum Jahreswechsel 2019/2020 den Restaurator im Kfz-Gewerbe etabliert und auch verordnet. Seit 2020 existiert auf Masterebene ein staatlich anerkannter Berufsabschluss im Oldtimerhandwerk. Der Restaurator im Handwerk war keine neue Erfindung. Diesen gibt es in anderen Gewerken bereits seit über 60 Jahren. Dieser Abschluss ist als Weiterbildungsprüfung konzipiert, d.h. Zugangsvoraussetzungen ist zunächst einmal grundsätzlich der Meisterbrief in einem Kfz-Gewerbe.
Möglicherweise kann der PAK bei einem bekannten Henne-Ei-Problem helfen. Tatsache ist: Interessenten fragen uns, an welcher Handwerkskammer die Kurse angeboten werden und die Ausbildung vorangetrieben werden könnten. Die können wir aber nicht benennen, weil die Kammern für die Einrichtung und Durchführung der Weiterbildung entsprechenden Aufwand betreiben müssten und dazu berechtigterweise fragen, welche konkrete Anzahl Interessierter diesen Kurs besuchen wird. Der ZDK sucht nach Möglichkeiten, diesen Kurs modular aufzubauen und möglicherweise analog zum Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) anzubieten. Es wird die Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass wir mit Unterstützung und nach mittlerweile 20 Jahren nun, mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren, eine
Grundlagenqualifikation umsetzen können.
Die Frage, wie das Problem aktuell lösbar ist, ist nicht einfach zu beantworten. Tom Fischer rät dringend zur Vernetzung bestehender Projekte, denn von den soeben geschilderten Pilotprojekten war bislang nichts bekannt. Holger Hahn rät als erstes zu einem Statement des PAK, dass wir derartige Projekte ausdrücklich unterstützen.
Ulf Schulz rät zu einem einfachen Ansatz und verweist auf die Kfz-Mechaniker-Ausbildung in den 90er Jahren, vor den Mechatronikern. Deren damalige Ausbildungsinhalte würden ausreichen, um heute zum Oldtimerexperten werden zu können. Die sich darauf anschließenden Spezialisierungen waren auch damals erforderlich. Er schlägt vor, sich vertieft darüber Gedanken zu machen, wie vorhandenes Wissen konserviert werden kann.
Tom Fischer hält entgegen, dass die heutigen Ausbildungsinhalte sich grundlegend unterscheiden. Die
Wissenskonservierung wird von der Initiative angestrebt und auch über die Stärkung des Netzwerks und der Szene vorangetrieben. Von Matthias Kemmer kommt der Einwurf, dass diese Diskussion seit über 20 Jahren geführt würde und nicht die Inhalte das Problem sind, sondern der gesetzliche Rahmen und die Frage zu den Kosten. Realistisch ist, dass bei einem Fahrzeuganteil von 0,5 Prozent am Fahrzeugbestand wird der Gesetzgeber keine Sonderregelung im Ausbildungsbereich einführen. Wichtig ist, Grundlagen in der Ausbildung zu schaffen, beispielsweise über den Restaurator im Kfz-Gewerbe, und anschließend über Spezialisierung, die Fertigkeiten weiterzugeben und zu bewahren. Wenn das vorher angesprochene Henne-Ei-Problem gelöst werden kann, wäre das ein riesiger Fortschritt.
Robert Schramm unterstützt das Empfehlungsschreiben an die Kammern, um nicht die Akzeptanz für das Berufsfeld zu verlieren.
Ivo Konzag spricht das Thema Motivation für junge Leute an. Die Ursachen sind vielfältig, fangen beim Vorhandensein und dem Standort der Werkstätten an, geht über den finanziellen Aufwand einer Ausbildung und geht bis zu den finanziellen Mittel für Gehalt der Azubis und Gesellen. Carsten Müller schlägt vor, sich zum Thema noch einmal zusammensetzen, beispielsweise in der übernächsten Sitzung, bis dahin beteiligte Verbände und Organisationen, wie den ZDH, gezielt anzusprechen und zur Sitzung einzuladen. Gefragt wird, wer von den hier Interessierten sich an der Aufarbeitung der Thematik beteiligt und die Kernpunkte aufarbeitet. Nach der Sitzung erfolgt die Koordination über Tom Fischer.
Kontaktvermittlung erfolgt nach der unmittelbar nach Sitzung oder über das Büro von Carsten Müller.
Ulf Schulz regt an, die nächste Sitzung des PAK vom Freitag in die Woche vorzuziehen.
Nach Absprache unter den Vorstandsmitgliedern wird Dienstag, 11. Juni 2024 zwischen 12:00 und 14:30 Uhr vorgeschlagen, um dann anschließend eine mögliche Ausfahrt zu organisieren.
Peter Diehl berichtet zum Sachstand zum Bleiverbot auf europäischer Ebene. Die Petition ist noch immer online, aber hat schon Erfolge erzielt. Es gibt eine mündliche Information von der Direktion Ökosysteme 1 der EU-Kommission zu Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, dass in nächster Zeit keine Aufnahme des Metalls Blei in den Anhang XIV der EU-Chemikalienverordnung geben wird. Er verweist auf die Formulierung
„in nächster Zeit, die zur weiteren Wachsamkeit auffordert. Daher sollte die ECHA-Arbeitsgruppe im PAK die Arbeit zwar ruhen lassen, aber sich nicht auflösen, um schnell reaktiviert und wieder einsatzfähig zu sein. Signalisiert wurde auch, sollte es doch zu einem Bleiverbot kommen, sollen auf jeden Fall Ausnahmen für das Handwerk eingeführt werden. In unserem Kontext könnte dann dem H-Kennzeichen auch wieder eine höhere
Bedeutung zukommen.
Ralph Grieser bezieht sich auf die vorherige Sitzung des PAK und die Diskussion um Authentizität von historischen Fahrzeugen. In den letzten Monaten haben sich zahlreiche weitere Fälle ergeben. Die individuellen Fragestellungen von Eigentümern, Sachverständigen, Prüforganisationen, Versicherungen etc. pp. Verlangen verschiedene Antworten. Aus diesem Grund befindet sich ein Oldtimer-Schutzverband zur sicheren Identifikation ‚echter‘ Oldtimer und der Wahrung des historischen Kulturguts in Gründung. Ein One-Pager dazu liegt dem Protokoll bei. Bei Fragen oder Anregungen dazu ist jederzeit ein Kontakt über die Mailadresse kontakt@oldtimer-schutzverband.de möglich.
TOP6_Oldtimer_Schutzverband_20240315
Christian Sauter schließt die Sitzung.
Die nächste Sitzung des Parlamentskreises findet statt am Dienstag, 11. Juni 2024 ab 12:00 Uhr im Raum K1, im Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), Invalidenstraße 44, 10115 Berlin – ! Eingang Pforte C, Schwarzer Weg ! statt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden hierzu rechtzeitig eingeladen.