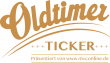Stellungnahme zur jährlichen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge älter als 10 Jahre im Rahmen der Revision der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Hintergrund und Argumente aus der Folgenabschätzung der EU-Kommission
Am 24. April 2025 hat die EU-Kommission einen Legislativvorschlag(1) zur Änderung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern vorgelegt. Die verschiedenen Maßnahmen des Legislativvorschlags sollen die Verkehrssicherheit erhöhen und übermäßige Luftschadstoff- sowie Lärmemissionen reduzieren.
Dabei geht die EU-Kommission davon aus, dass sicherheitsrelevante Mängel sowie Defekte und Manipulationen der Abgasnachbehandlung mit höherem Fahrzeugalter zunehmen. Dadurch seien die EU-Bürger nicht nur einem höheren Verkehrssicherheitsrisiko durch unsichere Fahrzeuge, sondern auch vermeidbaren Luftschadstoffemissionen ausgesetzt. Die EU-Kommission schlägt daher, wie bereits in einzelnen Mitgliedsstaaten geregelt, eine jährliche Hauptuntersuchung für Fahrzeuge vor, die älter als 10 Jahre sind.
Die EU-Kommission verfolgt mit dem Vorschlag das Ziel, die Zahl der Verkehrsunfälle und der Unfallopfer mit der Einführung jährlicher Prüfungen um ein Prozent zu senken. Als weiteres Argument führt sie auf, dass ältere Fahrzeuge pannenanfälliger und häufiger in Unfälle verwickelt seien. Pkw-Unfälle seien für den weitaus größten Teil der Todesfälle im Straßenverkehr verantwortlich. Obwohl technische Defekte nur einen geringen Anteil an den Unfallursachen ausmachen, spricht sich die Kommission für jährliche Untersuchungen aus mit der Begründung, dass diese einen erheblichen Unterschied machen könnten.(2)
Die EU-Kommission geht weiter davon aus, dass im Rahmen der Abgasuntersuchung als Bestandteil der Hauptuntersuchung die meisten Fahrzeuge mit defekter sowie ein Teil der Fahrzeuge mit manipulierter Abgasnachbehandlung entdeckt werden. Durch die frühzeitige Entdeckung und Behebung dieser Mängel könne ein signifikanter Teil der übermäßig ausgestoßenen NOx-, Partikel- und weiterer Luftschadstoffemissionen vermieden werden. Die jährliche Abgasuntersuchung würde laut EU-Kommission daher erheblich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen.(3)
(1) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/45/EU on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and Directive 2014/47/EU on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Union
(2) Impact Assessment Report on the Revision of the Directives of the Roadworthiness package, (Seiten 205-206)
(3) Impact Assessment Report on the Revision of the Directives of the Roadworthiness package, (Seiten 214-221)
Position des ADAC
Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist seit Jahrzehnten ein Kernanliegen des ADAC. Die Hauptuntersuchung ist etabliert und gesellschaftlich anerkannt. Für ihre Weiterentwicklung im Sinne der Verkehrssicherheit, des Umweltschutzes, der Datensicherheit und des Datenschutzes ist ihre Effizienz unabdingbar. Andernfalls könnte die gesellschaftliche Akzeptanz gefährdet werden.
- Ein kausaler Zusammenhang zwischen einer Verkürzung der Prüfintervalle und einer signifikanten Verbesserung der Verkehrssicherheit oder Luftqualität ist bislang nicht nachgewiesen.
Bei den Hauptuntersuchungen muss grundsätzlich zwischen umweltrelevanten und sicherheitskritischen Mängeln unterschieden werden, denn beides könnte zum Nichtbestehen der Inspektion führen.
Mit Blick auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit hält der ADAC die vorgeschlagene jährliche Überprüfung für unverhältnismäßig, da keine signifikant höhere Unfallgefährdung durch ältere Fahrzeuge feststellbar ist.
Die Verkehrsunfallforschung der TU Dresden hat in einer Studie(4) im Auftrag des ADAC nachgewiesen, dass eine Verkürzung der HU-Fristen auf ein Jahr keinen messbaren Einfluss auf die Verkehrssicherheit hat. Dank regelmäßiger, sachverständiger und umfassender technischer Inspektionen zeichnet sich die deutsche Fahrzeugflotte durch eine geringe Quote technischer Mängel aus. Zudem sind nur wenige der festgestellten Mängel unfall- bzw. sicherheitsrelevant.
Die Einführung einer jährlichen Hauptuntersuchung ist aus verkehrssicherheitstechnischer Sicht nicht verhältnismäßig. Technische Mängel sind nach Berichten des statistischen Bundesamts
(destatis) nur selten Hauptursache bei Unfällen mit Personenschaden.
Im Jahr 2023 starben 2.830 Menschen im Straßenverkehr, davon waren 25 Todesfälle (0,88 %) auf technische Mängel zurückzuführen. Getötete durch technische Mängel bei Pkw waren 7 (0,25%). Ein klarer Zusammenhang zwischen HU-Mängeln und Unfallzahlen ist nicht belegt, da die Datenlage zu ungenau ist. Auch internationale Vergleiche zeigen keine signifikanten Veränderungen bei Unfallzahlen in Ländern wie Finnland, Irland, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien und Schweden nach Änderung der Prüfintervalle.
Technische Mängel verursachen weniger als 1 % der tödlichen Unfälle, viele davon sind durch die HU nicht zu verhindern. Eine jährliche HU würde einen hohen Aufwand bedeuten, ohne dass ein relevanter Sicherheitsgewinn nachweisbar ist. Eine detailliertere Datenerhebung ist nötig, bevor eine solche Maßnahme gerechtfertigt werden kann.
Mit Blick auf die Verbesserung der Luftqualität setzt die Folgenabschätzung der EU-Kommission auf eine unzureichende Datenlage. Die Kommission räumt ein, dass wenig Informationen über den Anteil der Fahrzeuge mit defekter oder manipulierter Abgasreinigung vorliegen.(5) Die pauschale Darstellung der EU-Kommission ist an dieser Stelle nicht zielführend, da eine Abschätzung nach Fahrzeugtyp (Antriebstechnologie, Abgasreinigungsstandard) und Altersklasse für einzelne Mitgliedsstaaten erforderlich ist. Nur so kann die nationale Betroffenheit eingeschätzt werden. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland alle Grenzwerte zur Luftqualität eingehalten.(6) Eine Verkürzung des Prüfintervalls mit dem Ziel die Luftqualität zu verbessern ist daher weder notwendig noch effizient.
Ältere Fahrzeuge haben im Vergleich zu neuen Fahrzeugen eine geringere Fahrleistung. Sie nehmen im Bestand weiter ab und werden perspektivisch durch Fahrzeuge ohne Auspuffemissionen ersetzt. Mit der weiteren Entwicklung der Flottenzusammensetzung, insbesondere in Richtung Elektromobilität, wäre die vorgesehene Regelung mit deutlichem Mehraufwand verbunden und daher kritisch zu hinterfragen.
Nicht zuletzt werden die Luftreinhaltegrenzwerte ab 2030 deutlich verschärft. Hier gilt es, alle relevanten Emittenten in den Blick zu nehmen und nicht nur den Verkehrssektor, der gerade in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte gemacht hat und seinen Beitrag geleistet hat. Die Luft ist auch deswegen aktuell so sauber wie schon sehr viele Jahre nicht mehr.
(4) Verkehrsunfallforschung der TU Dresden „Einfluss der HU-Frist auf das Verkehrsunfallgeschehen“ – 2013
(5) Impact Assessment Report on the Revision of the Directives of the Roadworthiness package, (Seite 115)
(6) Pressemitteilung Umweltbundesamt vom 20.02.2025
Zudem ist die fortschreitende Entwicklung der fahrzeuginternen Eigendiagnosesysteme sowie die perspektivische Einführung von On-Board-Monitoring-Systemen (OBM) zu berücksichtigen. Dies wird es den Fahrzeugen zunehmend ermöglichen, betriebsrelevante Fehler selbstständig zu erkennen und zu melden.
Der Umfang und die Frequenz der Hauptuntersuchung sollten weiterhin in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen, und so den nationalen Besonderheiten und verkehrstechnischen Erfordernissen Rechnung tragen.
Die in Deutschland gültigen Prüffristen der Hauptuntersuchung gehen bereits über die Vorgaben der aktuellen EU-Richtlinie hinaus. So findet bei Pkw die erste Hauptuntersuchung bereits nach drei Jahren statt- ein Jahr früher als von der EU vorgegeben – und anschließend im zweijährigen Rhythmus.
Zudem wurde der Prüfumfang in den vergangenen Jahren erheblich erweitert, um den steigenden Anforderungen durch technologische Entwicklungen gerecht zu werden. Insbesondere Assistenzsysteme, E-Mobilitätskomponenten sowie das systematische Auslesen elektronischer Fehlercodes stehen zunehmend im Fokus. Auch im Bereich der Emissionsüberwachung wurden mit der Wiedereinführung der Endrohrmessung im Jahr 2018 sowie der Einführung der Partikelzahlmessung für Euro-6-Dieselfahrzeuge ab dem 1. Juli 2023 wesentliche Fortschritte erzielt.
Die Hauptuntersuchung in Deutschland erfolgt damit bereits heute auf einem sehr hohen Qualitäts- und Kontrollniveau – sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der technischen Tiefe der Prüfungen.
In den Mitgliedstaaten der EU haben sich, in Umsetzung der Europäischen HU-Richtlinie, unterschiedliche Systeme der Hauptuntersuchung etabliert. Sie unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Prüffristen, sondern auch hinsichtlich Umfang und Tiefe der durchgeführten Fahrzeugprüfungen. Das wirkt sich entsprechend auf die Kosten aus. So reichen die Kosten für eine Hauptuntersuchung von beispielsweise ca. 50 € in Spanien bis zu ca. 150 € in Deutschland. Aus Sicht des ADAC lassen sich die Wirksamkeit und die Verhältnismäßigkeit des Systems der Hauptuntersuchung nur im Zusammenwirken von Prüffrequenz, Prüfumfang und Prüftiefe sowie vor dem Hintergrund des jeweiligen nationalen Fahrzeugbestandes bewerten. Der ADAC hält deshalb eine EU-weite starre und einheitliche Vorgabe einer einjährigen Prüffrist ab dem Fahrzeugalter von 10 Jahren für nicht sachgerecht und fordert, auch künftig die Zuständigkeit dafür in den Mitgliedstaaten zu verankern.
Eine Verkürzung der Prüfintervalle würde zu einer spürbaren Erhöhung der Kosten führen und hätte damit nachteilige Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher.
Das Durchschnittsalter von Pkw liegt in Deutschland bei 10,6 Jahren. Eine Verkürzung der Prüffristen würde mehr als 23,4 Millionen Fahrzeuge betreffen – das entspricht rund 47,1 Prozent des Gesamtbestands. Unter Zugrundelegung durchschnittlicher Kosten von 150 Euro pro Hauptuntersuchung ergibt sich daraus eine zusätzliche jährliche Belastung von rund 1,8 Milliarden Euro für die Halter älterer Fahrzeuge.
Diese Mehrkosten würden vor allem Haushalte mit geringem Einkommen treffen, die sich keinen Neuwagen leisten können und auf ältere Fahrzeuge angewiesen sind. Die finanziellen Mittel, die künftig für häufigere Pflichtuntersuchungen aufgewendet werden müssten, stünden dann vielfach nicht mehr für sicherheitsrelevante Wartungsmaßnahmen oder notwendige Ersatzteile wie etwa Reifen zur Verfügung.
Vor dem Hintergrund dieser erheblichen finanziellen Mehrbelastung sowie der Ergebnisse der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden, die keinen signifikanten Sicherheitsgewinn durch verkürzte Prüfintervalle für ältere Fahrzeuge erkennen lässt, erscheint eine solche Maßnahme unverhältnismäßig.
Auch auf struktureller Ebene ergeben sich erhebliche Herausforderungen: Selbst die EU-Kommission geht davon aus, dass Prüfstellen und Werkstätten ihre Kapazitäten deutlich ausbauen müssten(7), um die zusätzlichen Hauptuntersuchungen durchzuführen. Angesichts des Fachkräftemangels ist es jedoch unrealistisch, dass das dafür benötigte Personal kurzfristig in ausreichender Zahl rekrutiert und qualifiziert werden kann. In der Folge drohen Terminengpässe bei Hauptuntersuchungen – mit negativen Auswirkungen auf alle Fahrzeughalter, unabhängig vom Alter ihrer Fahrzeuge.
Die gesellschaftliche Akzeptanz ist nicht gegeben.
Die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz für eine Verkürzung der Prüffristen wird durch eine nichtrepräsentative Umfrage(8) des ADAC auf adac.de(9) sowie in den sozialen Medien bestätigt.
Details zur Social-Media- & Web-Umfrage:
Insgesamt gab es über diese Kanäle 8.271 Teilnahmen. 1.438 über den Instagram Beitrag vom 29.04.2025, 1.967 über die Instagram Story vom 29.04.2025 und 4.866 über das Abstimmungstool des Artikels vom 25.04.2025.
Bis zum Tag der Auszählung (09.05.2025) wurde wie folgt abgestimmt:
- Instagram Beitrag: 4 % (58) „JA“ & 96 % (1.380) „NEIN“,
- Instagram Story: 18 % (362) „JA“ & 82 % (1.605) „NEIN“,
- Artikel: 2 % (97) „JA“, 96 % (4.672) „NEIN“ & 2 % (97) „EGAL“
(7) Impact Assessment Report on the Revision of the Directives of the Roadworthiness package, (Seiten 162-166)
(8) Hinweis: Diese Social-Media- & Web-Umfrage ist nicht repräsentativ, da sie auf einer selbstselektiven Stichprobe basiert und somit keine allgemeinen Aussagen über die Grundgesamtheit zulässt.
(9) Jährliche HU: EU will ältere Autos öfter zum TÜV schicke