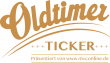Angriff auf die Mittelklasse
Wer in diesem Artikel auf technische Meilensteine und raffinierte Details hofft, der wird enttäuscht werden. Der Typ Stuttgart sollte als Nachfolger des 8/38 PS keine exklusive Käuferschicht mehr ansprechen, sondern sollte „der Benz für’s Volk“ werden. Er wollte seinen Klassenkonkurrenten Ford A, Opel 8/40, Adler Favorit und Citroën C6 Paroli bieten.
Der Zweiliter-Mercedes erfuhr bereits bei Einführung eine Preissenkung von satten 2.000 Mark im Vergleich zum Vorgänger. Während seiner Produktion wurde der Preissturtz noch weiter voran getrieben, so dass von den ursprünglichen 6.880 Mark nach drei Jahren nur noch 5.000 Mark Neuwagenwert geblieben waren.
Seine Mitbewerber konnten diese Kosten nur schwer und mit Einschränkungen unterbieten. Vor allem aber flog dem Produkt aus Schwaben ein ausgezeichneter Ruf voraus. Die Ausstattung und die geringe Reparaturanfälligkeit waren sicherlich für nicht wenige Kunden der ausschlaggebende Punkt, sich einen Daimler zu leisten. Außerdem war das damals ja auch schon ein gültiges Statussymbol, selbst wenn es „nur der Kleine“ war.
Hier werden wir die ungewöhnliche Erfolgsstory einmal aufzeigen. Als hervorragendes Beispiel dient uns dazu der Gewinner der Paul-Waring-Trophy eines MVC Pfingsttreffens. Selbstverständlich können wir nicht jeden Sachverhalt klären, aber wir werden uns Mühe geben, dass nur noch wenig Fragen offen bleiben . . .
Der Mercedes Typ Stuttgart war entstanden aus dem bei der Fusion von Daimler und Benz 1926 bereits vorhandenen 2-Liter Sechszylindermodell 8/38. Er galt in den Folgejahren als das Fahrzeug, welches ideal auf den „Selbstfahrer“ zugeschnitten war und mit welchem man breitere Käuferschichten erschließen wollte. Es war ein Fahrzeug der Mittelklasse, wogegen der zeitgleiche 12/55, der später Mannheim heißen sollte, eher als ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse galt, bei welchem ein Chauffeur üblich war. Da der von Porsche konstruierten 8/38 in seinen Anfängen nicht durch besondere Zuverlässigkeit glänzte, wurde er kontinuierlich verbessert und verändert. Hans Nibel, der Anfang 1929 der Nachfolger Porsches als Chefkonstrukteur wurde, war hierbei federführend. Ab dieser Zeit wurde das Fahrzeug offiziell Mercedes-Benz Typ Stuttgart 200 genannt. Dies zur Unterscheidung zum Mercedes-Benz Typ Stuttgart 260, der bei gleichem Aussehen mit einem auf 2,6 Liter vergrößerten und auf 50 PS Leistung angehobenem Motor besaß und zeitgleich erschienen war.
eher als ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse galt, bei welchem ein Chauffeur üblich war. Da der von Porsche konstruierten 8/38 in seinen Anfängen nicht durch besondere Zuverlässigkeit glänzte, wurde er kontinuierlich verbessert und verändert. Hans Nibel, der Anfang 1929 der Nachfolger Porsches als Chefkonstrukteur wurde, war hierbei federführend. Ab dieser Zeit wurde das Fahrzeug offiziell Mercedes-Benz Typ Stuttgart 200 genannt. Dies zur Unterscheidung zum Mercedes-Benz Typ Stuttgart 260, der bei gleichem Aussehen mit einem auf 2,6 Liter vergrößerten und auf 50 PS Leistung angehobenem Motor besaß und zeitgleich erschienen war.
Zwei Ausführungen
Äußerlich waren die Modelle Stuttgart 200 und Stuttgart 260, bei identischen Karosserien aus Sindelfingen, von dem flachen Kühler und den aus Blech gepreßten Speichenrädern geprägt. Die von Kronprinz und Hering hergestellten Räder wurden auch Artillerie-Speichenräder genannt, weil man zum Weiterbewegen eines mit solchen Rädern bestückten Geschützes verletzungsfrei mit den Händen hineingreifen konnte. Der Kühler des 260 war etwas tiefer nach unten gezogen, so dass im Gegensatz zum Stuttgart 200 die Abdeckung des Kurbellochs für die Andrehkurbel von der Kühlermaske erfaßt wird.
Bei beiden Fahrzeugmodellen waren aber die Grundzüge der Konstruktion gleich. Ein stabiler Leiterrahmen, dem durch den starren Einbau des Motors in Höhe der Schwungscheibe zusätzlich Stabilität verliehen wurde. Eine, durch Längsblattfedern abgefederte, starre Faustachse als Vorderachse und eine durch Längsblattfedern abgefederte starre Banjo-Hinterachse. Deren Antriebs- und Bremsreaktionen münden über ein Schubrohr in einer kugelförmigen Aufnahme am Getriebeausgang. Dort im Innern ist gleichzeitig das Kreuzgelenk der Kardanwelle enthalten. Das Getriebe hat drei Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Wahlweise war es möglich, zusätzlich einen durch Saugrohrunterdruck zu zuschaltenden Schnellgang zu ordern. Dieser installierte eine zusätzliche Untersetzung, die für geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Fahrgeräusche sorgte.
 Die mechanische Bremsanlage überträgt die Fußkräfte über Gestänge zu den Bremstrommeln der einzelnen Räder. Dort wird ein einteiliges Bremsband über eine Hebelübersetzung an die Bremstrommel gepreßt. Dadurch, dass das Bremsband von der Bremstrommel mitgerissen wird, ist sie selbstverstärkend auf der ganzen Länge. An der Vorderachse wird die Übertragung des Bremspedalwegs mit einem Druckbolzen durch das Zentrum des Achsschenkelbolzens bewerkstelligt, damit der Radeinschlag nicht für ungleiche Bremswirkung sorgt. Alle vier Zugstangen sind mit leicht nachstellbaren, selbstsichernden Handrädern versehen. Zur Servounterstützung und um ein Blockieren der Vorderräder auszuschließen sind in den Bremszugstangen der Vorderräder dicke Spiralfedern untergebracht und die Bremsbänder der Vorderräder sind um 5 mm schmaler als die der Hinterräder. Die Folge einer recht schlechten Bremsleistung resultiert genau aus diesem Umstand.
Die mechanische Bremsanlage überträgt die Fußkräfte über Gestänge zu den Bremstrommeln der einzelnen Räder. Dort wird ein einteiliges Bremsband über eine Hebelübersetzung an die Bremstrommel gepreßt. Dadurch, dass das Bremsband von der Bremstrommel mitgerissen wird, ist sie selbstverstärkend auf der ganzen Länge. An der Vorderachse wird die Übertragung des Bremspedalwegs mit einem Druckbolzen durch das Zentrum des Achsschenkelbolzens bewerkstelligt, damit der Radeinschlag nicht für ungleiche Bremswirkung sorgt. Alle vier Zugstangen sind mit leicht nachstellbaren, selbstsichernden Handrädern versehen. Zur Servounterstützung und um ein Blockieren der Vorderräder auszuschließen sind in den Bremszugstangen der Vorderräder dicke Spiralfedern untergebracht und die Bremsbänder der Vorderräder sind um 5 mm schmaler als die der Hinterräder. Die Folge einer recht schlechten Bremsleistung resultiert genau aus diesem Umstand.
Sämtliche Drehpunkte der Federgehänge der Längsblattfedern, die Lenkgelenke, die Achsschenkelbolzen und -büchsen, das Kreuzgelenk der Kardanwelle und bei späteren Fahrzeugen auch das Kupplungsdrucklager werden von einer automatischen Zentralschmierpumpe mit Öl versorgt. Die Verteilfunktion der am Rahmen befestigten Pumpe erfolgt über eine am Getriebe gegenüber dem Tachoantrieb liegende Antriebswelle. Das Öl wird aus dem Motorölkreislauf über den von der Ölpumpe erzeugten Druck abgenommen.
Die Kurbelwelle des wassergekühlten, seitengesteuerten Sechszylinder-Ottomotors ist mit sieben Hauptlagern versehen. Vorne unter der Riemenscheibe hat er einen Schwingungsdämpfer, denn Kurbelwellenbrüche an langen Kurbelwellen waren damals noch an der Tagesordnung. Zwischen dem dritten und vierten Zylinder ist soviel Platz, dass zur Vorwärmung das Kraftstoff-Luft-Gemisch quer durch den Motorblock und durch den Wassermantel angesaugt wird. So sitzt der Flachstromvergaser in Motormitte auf der linken Seite des Motors, wogegen der Ansaugkrümmer zur Verteilung des Gemischs an die einzelnen Zylinder und der Auspuffkrümmer auf der rechten Motorseite liegen.
Die Ölpumpe versorgt über ein im Hauptstrom liegenden Filter, mit entsprechenden Überdruckventilen durch eine Leitung sämtliche Hauptlager und die vier Nockenwellenlager auf direktem Weg. Die Pleuellager werden über Bohrungen, die von den Hauptlagerzapfen ausgehen, mit Öl versorgt. Allerdings sind die Pleuellagerzapfen hohl gebohrt und seitlich offen, wobei sich die Bohrung zur Mitte hin erweitert. Das bedeutet, dass der zur Schmierung des Pleuellagers notwendige Druck dort ausschließlich durch Zentrifugalkraft entsteht. Auch das Pleuelauge mit dem Kolbenbolzen soll so über eine am Pleuel befindliche Steigleitung mit Öl versorgt werden. Ähnlich bei der Nockenwelle, deren Lagerstellen ebenfalls mit Bohrungen versehen sind, damit Öl in das Innere der Nockenwelle gelangen kann. Das soll dann nämlich an der Spitze eines jeden der zwölf Nocken zur Schmierung austreten. Zusätzlich zweigt vom Hauptölstrom eine Leitung zu einem Nebenstromfilter ab. Hierüber werden Zentralschmierpumpe und  Öldruckmesser gespeist. Das im Nebenstrom gereinigte Öl wird über eine Leitung auf die Stirnräder geleitet. Diese liegen im Gegensatz zu ihrer Bezeichnung am Ende des Motors vor der Schwungscheibe. Neben der Nockenwelle wird über sie gleichzeitig die Lichtmaschinen-Nebenwelle angetrieben, über die die am Motorblock starr befestigte Lichtmaschine über Pallas-Gummikupplung angetrieben wird.
Öldruckmesser gespeist. Das im Nebenstrom gereinigte Öl wird über eine Leitung auf die Stirnräder geleitet. Diese liegen im Gegensatz zu ihrer Bezeichnung am Ende des Motors vor der Schwungscheibe. Neben der Nockenwelle wird über sie gleichzeitig die Lichtmaschinen-Nebenwelle angetrieben, über die die am Motorblock starr befestigte Lichtmaschine über Pallas-Gummikupplung angetrieben wird.
Erinnerungen!
Der Ahne war Professor an der Universität zu Köln und hatte dazu noch die Verpflichtung eines Ordnungsbeamten für Lebensmittel-Hygiene. Für seine Inspektionstätigkeit bei den umliegenden Betrieben benötigte der Herr Professor Müller ein Fahrzeug, dass einerseits zuverlässig, andererseits relativ preisgünstig und dennoch repräsentativ war.
„Als Schüler hatte ich Fotos meines Vaters entdeckt, auf denen manchmal ein Mercedes der 20er Jahre abgebildet war, und von dem mein Vater immer behauptete, dass dies das erste Fahrzeug seines Vaters, also meines Großvaters, gewesen sei. Es sollte ein 8/38 gewesen sein, der etwa 1929 gekauft worden war“, erinnert sich Rupert Müller des MVC Köln.
 Bereits kurz nach seinem Führerscheinerwerb begann sein Interesse für alte Fahrzeuge von Mercedes-Benz, denn sie hatten, im Gegensatz zu den Pontonformen der ablaufenden 60er Jahre, das Aussehen von Vorkriegsfahrzeugen mit den freistehenden Kotflügeln. So war sein erster, 1968 gekaufter Mercedes, ein 170 Db. Verständlich, dass mit den ersten Erfahrungen in einem alten Mercedes weiterhin im Hinterkopf der Gedanke an den besagten 8/38 des Großvaters saß. Dieser ließ den Wunsch aufkommen, irgendwann einmal ein solches Fahrzeug besitzen und fahren zu können.
Bereits kurz nach seinem Führerscheinerwerb begann sein Interesse für alte Fahrzeuge von Mercedes-Benz, denn sie hatten, im Gegensatz zu den Pontonformen der ablaufenden 60er Jahre, das Aussehen von Vorkriegsfahrzeugen mit den freistehenden Kotflügeln. So war sein erster, 1968 gekaufter Mercedes, ein 170 Db. Verständlich, dass mit den ersten Erfahrungen in einem alten Mercedes weiterhin im Hinterkopf der Gedanke an den besagten 8/38 des Großvaters saß. Dieser ließ den Wunsch aufkommen, irgendwann einmal ein solches Fahrzeug besitzen und fahren zu können.
Bei einem schmalen Studendenbuget konnte ein Kauf nur durch den Verkauf des 170 Db gelingen. So erwarb er sieben Jahre später einen aufbaufähigen, viele Jahre irgendwo in der DDR gelaufenen, Stuttgart 10/50, der äußerlich, optisch dem Auto des Großvaters entsprach. Das Fahrzeug war absolut desolat. Nicht lauffähig, Sitze vom Trabant, jede Menge fehlende Teile, aber Motor- und Rahmennummer übereinstimmend und – was besonders wichtig war – erschwinglich.
„Dein Großvater kaufte den 8/38 im Jahre 1929, um damit große Reisen zu machen“ erzählte mein Vater. „Ich war damas 19 Jahre alt“, fuhr er fort, „studierte bereits im 4. Semester Medizin, als Großvater das Auto bei der Kölner Niederlassung der Daimler-Benz AG auf der Luxemburger Straße kaufte. Und da er bar bezahlte, übernahm Mercedes die Kosten für die Führerscheinausbildung zweier Personen. Deine Großmutter und ich machten so damals den Führerschein auf Kosten von Mercedes.“
Für heutige Verhältnisse ist dies absolut unverständlich, da jeder Verkäufer lieber einen Leasing-Vertrag abschließen will und Bargeld in dieser Größenordnung längst der Plastikkarte gewichen ist.
 „Wenn wir damals auf Reisen gingen, hatten wir zwangsläufig Probleme mit dem Gepäck. Der schmale Koffer, der in den zwischen den Reserverädern und dem Fahrzeugheck liegenden Außenkoffer eingeschoben werden musste, reichte gerade für eine Person“, berichtete mein Vater. „Deshalb wurde der Beifahreresitz ausgebaut und statt dessen eine große Truhe mit all unserem Urlaubsgepäck dort hineingestellt. Und so fuhren meine Eltern mit mir und meinem jüngsten Bruder, der 10 Jahre nach mir geboren worden war, durch Deutschland, in die Schweiz und nach Frankreich. Meistens durfte ich fahren und dann saß mein Bruder Herbert auf einem Kissen oben auf dem gewölbten Deckel der Truhe und wenn das Wetter gut war hatten wir das Faltdach offen.“
„Wenn wir damals auf Reisen gingen, hatten wir zwangsläufig Probleme mit dem Gepäck. Der schmale Koffer, der in den zwischen den Reserverädern und dem Fahrzeugheck liegenden Außenkoffer eingeschoben werden musste, reichte gerade für eine Person“, berichtete mein Vater. „Deshalb wurde der Beifahreresitz ausgebaut und statt dessen eine große Truhe mit all unserem Urlaubsgepäck dort hineingestellt. Und so fuhren meine Eltern mit mir und meinem jüngsten Bruder, der 10 Jahre nach mir geboren worden war, durch Deutschland, in die Schweiz und nach Frankreich. Meistens durfte ich fahren und dann saß mein Bruder Herbert auf einem Kissen oben auf dem gewölbten Deckel der Truhe und wenn das Wetter gut war hatten wir das Faltdach offen.“
Und tatsächlich, bei einigen dieser winzigen schwarz-weiß Fotos kann man erkennen, dass die bei diesen Fahrzeugen mit Stoff bespannte Dachaussparung zu dreiviertel in Faltabschnitten zurückgeschlagen werden konnte und sich dadurch ein großes Schiebedach ergab. Und man sieht auch, dass das Auto des Großvaters Stoßstangen und zwei Reserveräder hatte.
„In der Schweiz fuhr Großmutter in den Graben, wobei wirklich nichts kaputt ging und sich niemand verletzte. Aber das hat sie schockiert und, wenn ich mich recht erinnere, ist sie später nie wieder Auto gefahren. Großvater und besonders ich fuhren sowieso viel lieber. Wenn man es eilig hatte, konnte man damals etwa 50 Kilometer in der Stunde als Durchschnitt erreichen. Nur die Stadtstraßen waren befestigt mit Kopfsteinpflaster, aber es gab auch schon die Schnellstraße nach Bonn, die betoniert und kreuzungsfrei ausgebaut war. Die besten Straßenbauer übrigens stammten damals aber aus Italien.“
Der Einduck, dass das Auto ausschließlich für großen Reisen bestimmt sein sollte, stimmte jedoch nur bedingt. Als Mediziner hatte Großvater wie gesagt noch die hygienische Aufsicht über verschiedene Firmen, so zum Beispiel über die Tropon-Werke, zu denen er dann in regelmäßigen Abständen fuhr. Das Auto diente also auch dienstlichen Zwecken.
„In Frankreich hatten wir mal mehrere Reifenpannen hintereinander, was sehr unangenehm war. Die Straßen waren ja noch längst nicht asphaltiert wie heute, und es lagen jede Menge Hufnägel auf den Straßen. Deshalb machte man große Reisen grundsätzlich mit zwei Reserverädern, und ein Schlauch gehörte auch zur Normalausrüstung. In der Fahrschule hatten wir lernen müssen, wie man einen Schlauch repariert und wieder einzieht. Da in Frankreich mussten wir aber dann tatsächlich die Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen, denn ein neuer Schlauch musste her. Wie sich später herausstellte, hatte man nicht die richtige Größe eingelegt, denn dann hatten wir mit diesem Reifen wieder einen Plattfuß, weil der Schlauch sich in Falten gelegt hatte.
Als der Wagen eine Laufleistung von 50 000 km hatte, sahen die Unterlagen von Mercedes eine Grundüberholung vor. Der 8/38 wurde also zur Luxemburger Straße zu Mercedes gebracht. Dort bot man dann die Überholung an, machte jedoch bezüglich der Motorüberholung Einschränkungen. Denn man wusste, daß mit dem Auto in erster Linie lange Strecken bewältigt worden waren. Und nach der Abnahme des Zylinderkopfes wurde der Motor dann als einwandfrei bezeichnet,“ berichtete mein Vater. „Aber dein Großvater bestand darauf, dass der Motor trotzdem überholt werden solle, was dann auch geschah.“
Eine Motorüberholung wurde damals bei eingebautem Motor durchgeführt, der Zylinderkopf und die Ölwanne wurden abgenommen, die Pleuel gelöst und die Kolben gezogen. Dann wurde bei eingebauter Kurbelwelle oben auf dem Motorblock ein Hongerät, welches elektrisch angetrieben wurde, aufgesetzt und die Zylinderlaufflächen wurden nachgehont. Anschließend wurden die Kolben meist mit neuen Kolbenringen versehen, und dann wurde das Ganze wieder zusammengebaut.
„Wie so oft wandte auch ich damals bei dem Gedanken auf ein eigenes Auto meinem Vater gegenüber einen Trick an“, berichtete mein Vater, „da ich damals in Berlin studierte, schrieb ich ihm, dass ich nun das Geld zusammen hätte, um mir ein Motorrad zu kaufen. Das hatte dann zur Folge, dass Großvater den Betrag zum Kauf eines gebrauchten Opel P 4 aufstockte.
Später, als ich dann in Rom studierte, brauchte ich dort gar kein Auto. Die Verkehrsverhältnisse waren nicht so, dass ein Auto nötig war. Also wurde der Opel P 4 mit in Großvaters Garage untergebracht“, erzählte mein Vater. „Allerdings war dies zu einer Zeit, als die Nazis bereits großzügig begannen, Fahrzeuge zu ‘beschlagnahmen’. Leider waren beide Fahrzeuge auf Großvaters Namen angemeldet, so dass die Nazis meinten, dass ein einziges Fahrzeug auch für einen Universitätsprofessor ausreichend sein müsste. Sie entschieden sich, das bessere einzuziehen. So musste dann mein Bruder Rupert den 8/38 zur Jahnwiese am Stadion bringen, abliefern und erhielt darüber einen Quittungsbeleg. — Was dann später aus dem Auto geworden ist, weiß ich nicht.“
Eine etwas andere Erfolgsstory
Doch nun zu dem Fragment, was Rupert Müller gekauft hatte. Es stellte sich anhand des Kommissionsbuchauszugs als Mercedes-Benz Stuttgart 260 Standard Limousine 4/6 heraus, also 4-türig 6-fenstrig. „Standard“ war damals die einfachere Ausstattung und unterschied sich zum „Luxus“ äußerlich bereits durch das Fehlen von Stoßstangen. Nur ein Reserverad war vorhanden, Radbefestigungen, Scheinwerfer und Verbindungsstange sind lackiert statt verchromt. Kühlerverschluß bzw. Sternunterteil ist aus Kunststoff. Es gibt keinen Außenkoffer und keine Schutzgummis als Kratzschutz beim Einstieg. Im Laufe der Jahre änderte sich ein Teil dieser Dinge, so dass neben Details der Innenausstattung ein Standardmodell immer am besten an den fehlenden Stoßstangen zu erkennen ist.
Da die Wiederherstellung der Karosserie aus vorangegangener, leidiger Erfahrung mit Holzaufbauten als das zunächst schwierigere Unterfangen erschien, begann er bei der Restaurierung mit dem Abheben des Karosseriekörpers vom Fahrgestell. Ein Stellmacher musste gefunden werden, der in der Lage war, anhand der Holzreste den unteren Rahmen und den hölzernen Vorderwagen nachzubauen. Holzrahmen und die abgenagelten, gesandstrahlten und grundierten Bleche wurden dann wieder zu einem Karosseriekörper zusammengesetzt. Die verbliebenen, noch gut erhaltenen Holz- und Blechpartien wurden abgeschliffen, grundiert und die Türen eingepasst. Das alles passierte auf dem bis dahin völlig unbehandelten Pressblechrahmen. Dann wurde die gesamte Karosserie, die jetzt wieder eine sehr stabile Einheit war, wieder vom Fahrgestell abgehoben und beiseite gestellt. Die „Technik“ konnte nun in Angriff genommen werden.
 Der Motor war wohl in den letzen Betriebsjahren ausschließlich mit unlegiertem Öl gefahren worden. Beim Herausziehen des Ölpeilstabs zeigte sich sauberes Öl, beim Öffnen der Ölablassschraube kam dann allerdings zunächst gar nichts. Erst nach dem Durchstoßen des dort abgelagerten Ölschlamms kam zunächst Wasser, dann Dreck und dann Altöl. Alles musste also zunächst zerlegt und von alter Ölkruste gereinigt werden. Der Motor sollte später ja mit einem gebräuchlichen HD-Motoröl betrieben werden. Die Kolben konnten mehr als einen Millimeter in der Bohrung hin und her bewegt werden, so dass ein Aufbohren und die Anfertigung neuer Kolben fällig wurde. Alle Kurbelwellenhauptlager und die Pleuellager mussten neu gegossen und der überarbeiteten Kurbelwelle angepasst werden. Die Wasserpumpe, deren Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung bestand, war völlig zerbröselt und unbrauchbar. Der Verteiler war falsch. Der Anlasser hatte verbrannte Wicklungen, und ihm fehlte das bronzene Antriebszahnrad mit sieben Zähnen. Der Vergaser war falsch, dafür war die Lichtmaschine vorhanden, aber es fehlte die Pallas-Gummikupplung. Bei all diesen Teilen wurde nicht überstürzt gehandelt. Alle, auch die Kopfdichtung und das Novotexrad wurde im Laufe der noch vor ihm liegenden Jahre auf diversen Ersatzteilflohmärkten zu erstaunlich günstigen Preisen erstanden.
Der Motor war wohl in den letzen Betriebsjahren ausschließlich mit unlegiertem Öl gefahren worden. Beim Herausziehen des Ölpeilstabs zeigte sich sauberes Öl, beim Öffnen der Ölablassschraube kam dann allerdings zunächst gar nichts. Erst nach dem Durchstoßen des dort abgelagerten Ölschlamms kam zunächst Wasser, dann Dreck und dann Altöl. Alles musste also zunächst zerlegt und von alter Ölkruste gereinigt werden. Der Motor sollte später ja mit einem gebräuchlichen HD-Motoröl betrieben werden. Die Kolben konnten mehr als einen Millimeter in der Bohrung hin und her bewegt werden, so dass ein Aufbohren und die Anfertigung neuer Kolben fällig wurde. Alle Kurbelwellenhauptlager und die Pleuellager mussten neu gegossen und der überarbeiteten Kurbelwelle angepasst werden. Die Wasserpumpe, deren Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung bestand, war völlig zerbröselt und unbrauchbar. Der Verteiler war falsch. Der Anlasser hatte verbrannte Wicklungen, und ihm fehlte das bronzene Antriebszahnrad mit sieben Zähnen. Der Vergaser war falsch, dafür war die Lichtmaschine vorhanden, aber es fehlte die Pallas-Gummikupplung. Bei all diesen Teilen wurde nicht überstürzt gehandelt. Alle, auch die Kopfdichtung und das Novotexrad wurde im Laufe der noch vor ihm liegenden Jahre auf diversen Ersatzteilflohmärkten zu erstaunlich günstigen Preisen erstanden.
Das Getriebe machte von den Zahnrädern her einen Spitzeneindruck, so dass ausschließlich eine gründliche Reinigung, die Erneuerung sämtlicher Lager und das Verchromen des Schalthebels anstanden. Das, zur Kardanwelle hin, folgende Kreuzgelenk war jedoch fast bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet und hatte etwa 2 cm Spiel. Die beiden bronzenen Gleitsteine und die halbkugelförmigen bronzenen Aufnahmen mussten nebst dem gehärteten Bolzen zur Aufnahme der Gleitsteine komplett nachgefertigt werden.
Die Hinterachse wurde zerlegt und gereinigt. Die Lager und das Tragbild vom Teller- und Kegelrad waren jedoch so gut, dass keine Eingriffe erfolgen mussten. Die außenliegenden Doppelrillen-Radlager wurden erneuert und die dort sitzenden Filzringe durch Änderung auf Simmeringe umgebaut. Die Lagerungen der hinteren Bremsquerwellen waren aber völlig hin und wurden durch Aufspritzen der Wellen und Erneuern der Bronzelager repariert.
Ähnliches an der Vorderachse. Neue Achsschenkelbolzen und -büchsen waren fällig, und auch hier waren die beiden Bremsquerwellen derart desolat, dass nur ein Flammspritzen und neue Bronzebüchsen helfen konnten. Gerade da zeigt sich deutlich, dass eine Zentralschmieranlage immer den Nachteil hat, dass alle von ihr nicht erfassten Schmierstellen oft sträflich vernachlässigt werden. Das Ausdrehen der Bremstrommeln und das Neubelegen der Bremsbänder und der Kupplung waren selbstverständlich.
Der Rahmen wurde gereinigt, sandgestrahlt, grundiert und mit hellem RAL-Chassislack gestrichen. Dann kamen lange Tage an der Drehbank, alle Federbolzen und Büchsen waren zu erneuern, und die einzelnen Federgehänge mussten aufgerieben werden. Die Federn mussten zerlegt, gesandstrahlt, gesprängt und wieder zusammengebaut werden. Sämtliche Zentralschmierleitungen verlangtem mit frischem Öl durchgepumpt und richtig verlegt zu werden. Erst dann sollten die vorbereiteten Aggregate wieder ihren Platz im Rahmen finden können.
Dass wähern der fast zwanzigjährigen Restaurationstätigkeit auch viele Informationen gesammelt wurden, braucht ja wohl keine gesonderte Erwähnung. Bei den meisten Stuttgart-Fahrzeugen war daher zwischenzeitlich hinsichtlich der Räder aufgefallen, dass die Radmuttern, die aus verchromten, bronzenen Hutmuttern bestehen, oft oben gerissen oder aufgeplatzt waren. Oder dass sich eine zweite oder dickere Unterlagplatte zwischen der Felge und den Radmuttern befand. Schlussfolgerung hieraus: Die Felgen pressen sich zusammen und die Räder lockerten sich. Also wurde ein Rad auf der Rückseite mit der Drehbank aufgetrennt. Und richtig, es befindet sich ein runder Hartholzkern im Bereich der Radmuttern. Das Holz ist natürlich morsch. Deshalb wurden alle Räder rückseitig aufgetrennt und eine dicke, entsprechend der Bolzenlöcher gebohrte und angesenkte, runde Aluplatte eingelegt und anschließend wieder zugeschweißt. Da man auch mit Sandstrahlen dabei nicht überall hinkommt, wurden alle Felgen an unsichtbaren Stellen angebohrt. Tagelanges, in einer mit Korrosionsschutzöl gefüllten runden Tonne, fluten, um dann wochenlang wieder austropfen zu können waren die nächsten Schritte.
Die Kotflügel und die Motorhaube wurden von einem Blechexperten bearbeitet. Ein wirklicher Könner seines Fachs, der die Blechteile ausschließlich autogen einschweißte. Hierbei schnitt er kurioserweise immer schmale Blechstreifen von der Blechtafel, die er als Material für das einzuschweißende Teil benutzte. Dies an Stelle eines herkömmlichen Schweißdrahtes. Die beiden unterhalb der Türen befindlichen Einstiegsbleche und das Heckabschlußblech unter dem Koffer gab es als Nachfertigung von einem Freund, der ebenfalls zeitgleich restaurierte. Die richtigen Scheinwerfer und die fehlenden Halter mit der Verbindungsstange waren längst gefunden. Aber der vorhandene Kühler war falsch. Nicht nur dass er von dem kleineren Modell stammte, er hatte auch ein völlig falsches Netz. Ein passender Kühler mit korrekter Kühlermaske konnte aufgetrieben werden, allerdings war eine Reparatur fällig. Doch wer ist in der Lage, einen solchen Kühler wiederherzustellen? Dazu ist zu sagen, dass derartige Kühler aus ganz vielen waagerecht liegenden Messingröhrchen eines sehr dünnen quadratischen Querschnitts besteht. An ihrem vorderen und hinteren Ende werden sie durch einen eingelegten und verlöteten Draht auf etwa 1,5 mm Distanz gehalten. Durch eben diese Distanz fließt dann das Wasser, wogegen die Luft durch die Röhrchen strömt. Bei einer derartig hohen Anzahl von Lötstellen sind Schwachstellen förmlich vorprogrammiert. Das wusste man auch schon damals, so dass man sehr bald von dieser Konstruktion Abstand nahm. Das Gespräch kam darauf, dass es in England Experten für diese Art Kühler gab. Also gab es einen Anlass für eine Tour nach England. Er fuhr dort hin, nahm mit großem Erstaunen war, wie dort gearbeitet wird. Als das fertige Produkt vor lag, war die Begeisterung groß. Etwa 750 m (!) Messingrohr mit unter 0,5 mm Wandstärke im Abmaß 6 x 6 mm waren zu Päckchen von 10 x 12 so gepackt und zusammengelötet worden, dass ein Unterschied zu vorher so gut wie nicht zu erkennen war. Diese Leistung, wie sich später herausstellen sollte, verbunden mit einer absoluten Spitzenfunktion.
Zwischenzeitlich hatten sich weitere, wichtige, fehlende Teile eingefunden. Der Windschutzscheibenrahmen, Fensterheber, Winker, Türgriffe und jede Menge Kleinteile für die Innenaustattung. Aber immer noch keine Sitze, so dass der Gedanke an eine Nachfertigung der Sitze reifte.
Der Lackierer allerdings schlug beim Anblick der vielen verschiedenen Grundierungen auf der Karosserie die Hände zusammen und begann damit, erst einmal alles wieder abzuwaschen, um einen einheitlichen Lackaufbau herzustellen. Der Aufenthalt beim Lackierer kam sehr gelegen, denn die Kündigung einer, gemeinsam mit meinem Freund gemieteten, Halle lag nämlich auf dem Tisch. Da die Farbkombination schon lange feststand, war ein weiteres Eingreifen nicht erforderlich. Das Auto aber für fast ein dreiviertel Jahr aus dem Sinn.
In der heimischen Doppelgarage musste es danach weiter gehen. Die Elektrik fiel nicht schwer, so dass einem Motorlauf bald nichts mehr im Wege stand. Zu diesem Ereignis waren Freunde eingeladen. Es zeigte sich, dass der Motor perfekt lief und das Fahrzeug, auf einem kleinen Hocker sitzend, durchaus gefahren werden konnte. Allerdings zeigte der Motor mit dem eingefüllten Castrol GTX 3 schlechen Öldruck. Sobald der Motor betriebswarm war, zeigte das Anzeigegerät im Leerlauf so gut wie nichts mehr an. Aber die üblichen Prüfungen ergaben, dass durchaus noch Öl bewegt wurde. Alle weiteren Versuche wurden vorsichtshalber abgebrochen.
Umfragen im Kreise der Besitzer solcher Autos lauteten fast übereinstimmend: Die Motoren haben im warmen Zustand im Leerlauf keinen Öldruck! SAE 40-50 ist Mindestvoraussetzung und es reicht, wenn während der Fahrt etwas am Öldruckmesser zu sehen ist, es geht aber auch nichts kaputt. Einer sagte, dass er, damit er dieses Elend nicht sieht, regelmäßig einen Zettel über das Messgerät klebt. Die unterschiedlichen Betriebsanleitungen sprechen einmal von „2 Atü, wenn der Motor läuft“, ein anderes Mal von „2,5 Atü bei voller Drehzahl“. Nachdem eine optimal mit neuen Zahnrädern versehene und nach allen Regeln der Kunst verbesserte Ölpumpe nur unwesentlich Besserung erbrachte und auch eine Kontrolle des gesamten Schmiersystems mit Ölüberdruckventilen und Filtern keine Unregelmäßigkeiten ergab, war das Latein am Ende.
Sollten doch nicht die sündhaft teuren, gegossenen Lager alle ruiniert werden. Andererseits bei dem Wunsch, auch einmal spontan mit dem Auto fahren zu können, kam Öl in der Konsistenz von Langnese-Honig nicht in Frage. Da also die Sache keine Ruhe ließ, beschloss er, durch höhere Ölpumpenräder die geförderte Ölmenge zu erhöhen. Das muste bei gleichen Gegebenheiten zwangsläufig zu einem besseren, höheren Öldruck führen. Nach dem Motto: Zuviel Öl an den Lagerstellen eines Motors hat noch nie geschadet. Eine exakt gebohrte Zwischenplatte aus dem gleichen Grauguss wie das Ölpumpengehäuse galt es herzustellen, wobei die Zahnräder dann um die Hälfte länger werden sollten. Der Erfolg stellte sich ein, der Öldruck ist bei kaltem Motor gut 2 bar im Leerlauf und schnellt auf über 6 bar hoch. Er sinkt jetzt auch nach Dauervollgasfahrt im Sommer nicht unter 0,8 bar im Leerlauf. Gefahren wird immer konsequent das dünnflüssige Mehrbereichsöl.
Zeitgleich mit den Ölpumpenexperimenten kam eines Tages ein Anruf eines Autosattlers in meiner Nähe, der sich auf ein Gespräch mit Peter Steenbuck berief. Wäre doch so ein Auto vorhanden . . . und er hätte nun ein ebensolches neu auszustatten . . . und ob nicht Bilder davon vorhanden wären . . . wie so ein Auto von innen auszusehen hat?!
Natürlich sind einige Bilder im Besitz, und selbstverständlich würde Hilfe geboten, war die Antwort. Dann jedoch kam die erste Frage, ob denn auch Sitze in dem Auto seien und ob man die denn eventuell nachbauen könne. Beides wurde derart spontan mit „kein Problem“ beantwortet, dass der Termin kaum noch erwartet werden konnte. Tatsächlich, da stand doch ein nahezu identisches Auto. Ebenfalls grau lackiert, erhielt es eine neue Innenausstattung. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße: Sitze leider verkehrt! Es handelte sich bei den Vordersitzen um eine Ausführung, wie sie zum Liegendtransport eines Kranken nur in einem der seltenen „Arztwagen“ Verwendung fanden. Die Rückenlehnen waren waagerecht abzuklappen. Allerdings von den dort zu sehenden Arbeiten so angetan, wurde das Angebot eines Freundes auf Ausleihen seiner Sitze wahr genommen und dort nicht nur die Sitze nachfertigt, sondern auch der komplette Innenausschlag ausgeführt.
Pfingsten 1997 war dann auf Druck hin der Polsterer fertig geworden. Natürlich war das Auto in Details weit davon entfernt wirklich fertig zu sein. Aber es reichte zur weiteren Motivation, wenn auch die Anreise noch nicht auf eigener Achse sondern per Hänger erfolgte.
Das sollte dann erst 1998 sein, als er gemeinsam mit seinem Vetter auf der B 42 immer am Rhein entlang zum Pfingsttreffen nach Ladenburg anreiste. Dazu ist zu sagen, dass ein Mercedes Stuttgart Standard ohne Schnellgang bei einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 85 km/h seine Leistungsgrenze erreicht hat. Als rollendes Verkehrshindernis sind also Autobahnen in jedem Fall tabu. „Aber, die Aussage meines Vaters trifft tatsächlich zu, dass bei freier Strecke (also ohne Ampel an jeder Ecke) auch heute noch ein Schnitt von 50 Kilometern in der Stunde drin ist. Beim Pfingsttreffen des selben Jahres hat mich meine Tochter überredet, an allen drei Wettbewerben teilzunehmen. Das hatte dann zur Folge, dass ich die Paul-Warring-Trophy gewann.“
Unter den Kennern gilt dieser 260 als exzelent gemachtes Fahrzeug und Zweifeler können ihn mit größter Wahrscheinlichkeit auch bei künftigen MVC Pfingstentreffen bewundern.