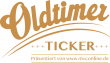Der ADAC präsentiert das Protokoll der Sitzung des Parlamentskreis Automobiles Kulturgut im Deutschen Bundestag (PAK) vom 6. Juni 2025 mit den Anhängen zu Ihrer Kenntnis.
Hinweis: Die Protokolle und Anlagen der bisherigen Sitzungen finden Sie unter: https://www.adac-motorsport.de/parlamentskreis-automobiles-kulturgut
 ZEI T: 6. JU NI 2025, 12:02 B I S 15:09 UH R
ZEI T: 6. JU NI 2025, 12:02 B I S 15:09 UH R
OR T: SI T Z U N G S S A A L E.400,
PAUL-LÖ B E-HA U S DE S D E U TS C H E N BU N DE S T A G E S,
KO N R A D -AD E N A U E R STRAS SE 1, 10117 BE R L I N
ANWESEND: VGL. TE I L N E HM E R LI ST E
TOP 1 Eröffnung der Sitzung & Begrüßung – Carsten Müller | MdB
Carsten Müller eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden zur ersten Sitzung des PAK mit Gästen in der neuen Legislaturperiode. Es berichtet von der unmittelbar zuvor stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Parlamentskreises für die 21. Legislaturperiode im Kreise der Abgeordneten. In der Vorläufersitzung wurde neben der bisherigen Arbeit des PAK im Jahr 2009 zu den aktuellen Themen und Schwerpunkten ausgeführt. Alle interessierten Abgeordneten sind zu den PAK-Sitzungen in dieser Wahlperiode herzlich eingeladen. Carsten Müller führt weiter aus, über seinen Bericht gegenüber den Kolleginnen und Kollegen zur Expertise in den Sitzungen sowie der kompetenten und vertrauensvollen Zusammenarbeit im Parlamentskreis selbst. Gesondert
betont wurde die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit dem teilnehmenden Vertreter des Bundesverkehrsministeriums sowie dem Haus an sich – und zwar vollkommen unabhängig, welche Farbe das Ministerium gerade trug bzw. trägt. Carsten Müller berichtet zudem, dass die Abgeordneten ihn einstimmig zum PAK-Vorsitzenden wiedergewählt haben. Er führt das Amt gern fort und freut sich auf die gute Zusammenarbeit auch in den nächsten vier Jahren.
TOP 2 Young- und Oldtimer im Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker/in – Joachim Syha | Zentralverband Deutsches Kfz -Gewerbe
Joachim Syha führt in die Thematik ein und stellt die historische Entwicklung zum heutigen Ausbildungsberuf „Mechatronikerin/Mechatroniker“ dar. Auf Basis der historischen Weiterentwicklung des Berufsfeldes und der aktuellen Wandlung des Mobilitätssektors wird auch die mögliche Fortentwicklung des Ausbildungsberufs skizziert. Die von Joachim Syha genutzte Präsentation liegt dem Protokoll bei. >TOP2_Ausbildungsberuf_20250606_red
Erkennbar ist, dass durch den stetigen Wandel und zunehmende Komplexität der Fahrzeuge sowie der Vielfalt der Antriebssysteme und verbauten Komponenten auch die Anforderung an die Inhalte der Ausbildungsverordnung einem stetigen Wandel unterworfen ist. Beispielhaft werden die Schwerpunkte in den Bereichen Mechanik, Elektrik, Mechatronik, Elektrik, Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung skizziert. Richtigerweise orientiert sich das Ausbildungssystem an den aktuellen Fortschritten, die bei den Lehrinhalten entsprechend abgebildet werden. Das führt dazu, dass weniger relevant werdende, bisherige Lehrinhalte reduziert werden, z.B. im Bereich der Verbrennertechnik oder der Metallbearbeitung. Auf diese Weise drohen im Laufe der Zeit wichtige und notwendige Techniken und Fähigkeiten verlorenzugehen, die benötigt werden, um künftig an heutigen Young- und Oldtimern arbeiten zu können. Diese „Lücken“ in der Ausbildung müssen über Zusatzqualifikationen geschlossen werden.
Aber selbst, wenn beispielsweise ab 2035 kein Verbrennerfahrzeug mehr hergestellt werden sollte, sollte die Brennertechnik in der Ausbildungsverordnung erhalten bleiben. Die entsprechenden Diskussionen werden jedoch sehr herausfordernd. Es gab bereits Versuche und Anstrengungen, den Bereich der Young- und Oldtimer im Ausbildungsbereich zu stärken, etwa im Jahr 2013. Damals wurde eine Zusatzqualifikationen für „Old- und Youngtimer-Technik“ eingeführt, deren Lehrinhalte zuvor nicht mehr im modifizierten Berufsbild des Mechatronikers integriert und erhalten werden konnte. Der Erfolg der Maßnahme war überschaubar, obwohl gleichzeitig ein erheblicher Aus- und Weiterbildungsbedarf für die Pflege der klassischen Fahrzeuge besteht. Klar ist, dass auch diese Fähigkeiten auch zukünftig vor allem über Zusatzmodule oder ergänzende Angebote realisiert und vermittelt werden müssen.
In diesem bereits verschärftem Lagebild wirkt nun zusätzlich der Generationenwechsel nachteilig. Die Generation der Babyboomer verlässt aktuell den Arbeitsmarkt und nimmt dabei sehr viel Wissen mit. Was in den kommenden Jahren nicht bewahrt werden kann, droht für immer verloren zu gehen. Joachim Syha schlägt daher vor, eine externe Expertengruppe zu bilden, die die Überarbeitung der Ausbildungsverordnung mit dem Blick auf Erhalt der Befähigung der Arbeit an historischen Fahrzeugen in den Fokus nimmt. Ziel sollte ein Vorschlag zum Erhalt und vor allem zur Weitergabe des Wissens sein. Diese Anregungen müssten dann aktiv in die stetigen Diskussionen zur Fortentwicklung des Ausbildungsberufs eingebracht werden.
Peter Diehl verweist auf die 2022 gegründete Initiative „Classic meets Future“, die im März 2024 im PAK vorgestellt wurde. Diese Initiative zielt exakt auf Mitarbeitergewinnung und die Weitergabe von Wissen. Er bittet um Einschätzung, ob ein nichtstaatliches Zertifikat hier ein Ansatzpunkt wäre. Joachim Syha berichtet von vergleichbaren Initiativen und Lehrgänge, bei denen versucht wurde, nichtstaatliche Angebote zur Fort- und
Weiterbildung im Ausbildungssektor zu verankern. Diese wurden jedoch wieder eingestellt, weil die Nachfrage von Seiten der Betriebe sehr begrenzt war. Dennoch wird eine Chance gesehen, hier ein Angebot für eine Qualifizierung von Fachkräften im für Young- und Oldtimerbereich mit einer nichtstaatlichen Zertifizierung zu etablieren, weil der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften für Young- und Oldtimer manifestiert ist. Der Referent betont die zentrale Notwendigkeit eines koordinierten Ansatzes der Branche. Es gilt, vorhandene Initiativen und Angebote zu bündeln und Finanzmittel für den Impuls verfügbar zu machen. So sollte es möglich sein, Fachkräfte für das Qualifizierungsangebot zu gewinnen und langfristig zu binden.
Johann König führt aus, dass das Fachkräftethema mehrfach diskutiert wurde, aber jetzt der Zeitpunkt ist, um endlich konkreter zu werden. Konkreter, welche Forderungen genau an die Branche und auch an die Politik zu richten sind. Er bietet an, im Oldtimer Ratgeber des ADAC mehrere Seiten für diese Thematik freizuhalten, um zu informieren, um auszuführen, worum es geht und auch Ansprechpartner für Interessenten zu benennen. Für die Facharbeitskreise wäre ebenfalls eine Koordination wichtig, um Ideen zu bündeln. Joachim Syha unterstützt Ideen und regt kleine, themenspezifisch gebündelte Arbeitskreise an, die zielorientiert agieren.
Dr. Gundula Tutt skizziert den seit mehr als zehn Jahren etablierten Schweizer Ausbildungsgang „Restaurator mit eidgenössischem Fachausweis“ mit den Fachrichtungen Mechanik, Elektrik und Karosserie. Es bietet sich an, dieses Modell in wesentlichen Zügen auf Deutschland übertragen, zumal die handwerklichen Maßstäbe nahezu identisch sind. Getragen wird das schweizer Modell von einer Initiative, die u.a. von Sammlungen und Sammlern finanzielle unterstützt wird. Es ist ein Erfolgsmodell: Jede Absolventin und jeder Absolvent ist am Markt hochbegehrt. Mittlerweile haben auch Deutsche diesen, einem Meister vergleichbaren Abschluss, erlangt. Dem Zentralverband ist dieses Modell bestens und von Beginn gut bekannt, aber Joachim Syha schränkt ein, dass die Vorgaben des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) einer 1:1 Übernahme entgegenstehen. Das BBiG bietet im § 6 die Möglichkeit einer „Erprobungsverordnung“, auf die hier möglicherweise zurückgegriffen werden könnte. Für die Umsetzung einer Erprobungsverordnung bedarf es jedoch breiter politischer Unterstützung, weil weitere Player, etwa auch das Bundeswirtschaftsministerium, unterstützen müssen. Diesen Aspekt aufgreifend schlägt Carsten Müller vor, eine konzentrierte Aufarbeitung des Themas in kleinem Kreis anzustrengen und auf dieser Grundlage mit dem Bundesbildungsministerium sowie weiteren relevanten Akteuren in Kontakt zu treten. Der
Arbeitskreis soll gebildet werden aus Peter Diehl, Robert Schramm, Mika Hahn, Fritz Cirener, Joachim Syha sowie Dr. Ekkehard Pott. Angefragt wird ebenfalls bei Robert Kayser. Dr. Gundula Tutt unterstützt den Arbeitskreis flankierend. Matthias Kemmer warnt vor zu großen Hoffnungen auf eine Änderung des BBiG, denn dieses regelt alle Ausbildungsberufe. Unser Oldtimerbereich ist klar zu spezifisch und zu klein. Aus Sicht des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe bietet das BBiG bereits heute eine sehr gute Grundlage, um die Bedarfe im Young- und Oldtimerbereich durch mögliche Zusatzqualifikationen zu bedienen. Es gab und gibt im Kontext der Oldtimerspezialisierung regelmäßig Modellprojekte, die aus verschiedenen Gründen scheitern. Er regt an, im diskutierten Arbeitskreis die bisherigen Erfahrungen aufzuarbeiten und vor allem auch die innovative Zielsetzung der Münchener Initiative zu berücksichtigen. Dr. Gundula Tutt relativiert die Argumentation des zu kleinen Sektors der Oldtimerfachkräfte mit dem Hinweis auf die Büchsenmacher. Diese sind ein zahlenmäßig deutlich kleinerer Sektor und bilden dennoch bis heute sehr spezifische und begehrte Fachkräfte aus. Carsten Müller bittet Peter Diehl gemeinsam mit seinem Büro diese Expertengruppe zu bilden und schlägt eine erste Rückmeldung und Einschätzung für die erste Sitzung im Kalenderjahr 2026 an.
TOP 3 FIVA World Event „130 Jahre erste Motor -Omnibus-Linie der Welt“ – Tiddo Bresters | FIVA
Der Präsident der FIVA, Tiddo Bresters führt zum FIVA World Event Utilitarian 2025 „130 Jahre Erster Motor-Omnibus der Welt“ aus. Die FIVA feiert gemeinsam mit der Stadt Netphen, dem ADAC sowie vielen engagierten Einzelpersonen das Jubiläum der ersten Omnibuslinie der Welt mit einem FIVA World Event. Dieses 130-jährige Jubiläum ist ein außergewöhnlicher Meilenstein der Mobilitätsgeschichte, der mit einem tollen Programm und über 100 historischen Bussen vor Ort gefeiert werden wird. Die FIVA und Organisatoren nutzen das Jubiläum und richten den Fokus des Events nicht nur auf die historische Mobilität, sondern auch auf aktuelle Fragen im Nutzfahrzeug- und Oldtimerbereich, wie etwa Führerscheinbedingungen, Nachwuchsfragen oder Straßensicherheit. Die vom FIVA-Präsidenten verwendete Präsentation liegt dem Protokoll bei. >TOP3_FIVA_Event_130_Jahre_Omnibus_20250606_red
FIVA und ADAC laden alle Interessierten sehr herzlich nach Netphen ein.
TOP 4 EU-Richtlinie Hauptuntersuchung Fahrzeuge – Gabriel Lecumberri | FIVA
Gabriel Lecumberri führt zur FIVA-Stellungnahme im Rahmen des EU-Kommissionsvorschlags der Revision der Europäischen Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern vom 24. April 2025 aus.
Die EU-Kommission verfolgt das Ziel, die Zahl der Verkehrsunfälle und der Unfallopfer zu senken. Sie geht davon aus, dass sicherheitsrelevante Mängel sowie Defekte und Manipulationen der Abgasnachbehandlung mit höherem Fahrzeugalter zunehmen. Deshalb wird unter anderem eine jährliche Hauptuntersuchung für Fahrzeuge gefordert, die älter als zehn Jahre sind.
Grundsätzlich unterstützen FIVA und Oldtimerszene die Zielsetzung zur Senkung der Anzahl der Unfallopfer sowie der Verkehrsunfälle. Kritisiert wird die pauschale Gleichsetzung von Fahrzeugalter mit Verkehrsunsicherheit bei Nichtberücksichtigung des Wartungszustandes. Die pauschale Annahme, dass einer Verkürzung der Prüfintervalle zur signifikanten Erhöhung der Verkehrssicherheit führt, kann durch keine wissenschaftliche Studie belegt werden. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Fahrzeugalter und Verkehrssicherheit bzw. Verkehrsunsicherheit ist nicht nachweisbar. Die vorgeschlagene jährliche Hauptuntersuchung ab einem Fahrzeugalter von zehn Jahren ist daher unverhältnismäßig.
Die von der Kommission im Vorschlag angeregte Anti-Manipulationsprüfung ist von ihr ohne klare Definition verankert. Damit geht ein latentes Risiko einher, dass legitime Reparaturen oder Restaurierungen fälschlicherweise verboten werden. Die FIVA wird sich im Gesetzgebungsverfahren des Europäischen Parlaments sowie des Rates wir hier dargestellt klar positionieren, um die notwendigen Änderungen im Verfahren durchzusetzen.
Christian Theis führt zum gegenwärtigen Sachstand aus sich des Bundesverkehrsministeriums aus. Das Bundesverkehrsministerium befindet sich als federführendes Haus mit dem mitberatenden Bundesumweltministerium in Abstimmung. Das Verkehrsministerium lehnt den Jahresintervall für Hauptuntersuchung älterer Fahrzeuge als unbegründet ab und hat das im Europäischen Rat bereits klar kommuniziert. In der Regel basiert die EU-Annahme auf der primären Mängelquoten bei der Vorstellung
der Fahrzeuge zu Hauptuntersuchungen. Die Fallzahlen steigen im Alter, aber mit der Wiedervorstellung nach Mangelbeseitigung und Erteilung der Plakette ist das Fahrzeug verkehrssicher und wieder uneingeschränkt für den Straßenverkehr zugelassen, so dass ganz klar kein höheres Risiko für die Verkehrssicherheit einhergeht. Carsten Müller dankt dem Vorredner und ergänzt, dass er sich mit Veröffentlichung des Entwurfs direkt an die Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Parlaments wandte. Johann König greift die 2013er-Studie der TU Dresden auf. Diese zeigt klar auf, dass es keinen Zusammenhang von zunehmendem Fahrzeugalter und abnehmender Verkehrssicherheit gibt. Auch die Betrachtung der Tarife der Kraftfahrzeugversicherung widerlegt die Annahme der EU. Bei erhöhtem Schadensaufkommen älterer Kraftfahrzeuge würden die Versicherungstarife mit zunehmendem Fahrzeugalter ansteigen. Das ist ganz klar nicht der Fall.
Ulf Schulz bittet die Prüforganisationen um eine Einschätzung zur Forderung der jährlichen Hauptuntersuchungen. Ergänzend führt er die zusätzlichen Kosten der Hauptuntersuchung durch verkürzte Prüfintervalle an. Eine jährlichen HU ab dem zehnten Jahr verdoppelten die Kosten, wenn die Prüforganisationen die Preise nicht reduzieren würden. Dr. Ekkehard Pott führt aus, dass er unmittelbar mit den Prüforganisationen in Kontakt trat. Die Prüforganisationen verweisen klar auf absehbare Kapazitätsengpässe, wenn das Prüfaufkommen derart erhöht würde. Unstrittig ist, eine Hauptuntersuchung kann vom Umfang nicht abgespeckt werden und wäre weiterhin mit dem gleichen zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand verbunden.
Peter Steckel weist in diesem Kontext auf ein in etwa vergleichbares Regelproblem, das besonders für historische Nutzfahrzeuge relevant ist: die Bremssonderuntersuchung. Carsten Müller regt an, dieses Thema in einem Schreiben gegenüber dem Bundesverkehrsministerium aufzugreifen und um Unterstützung für eine Änderung für historische Nutzfahrzeuge mit ihren geringen Jahreslaufleistungen zu bitten.
>TOP4_PAK FIVA – Juni 2025 – final_20250606
TOP 5 Einfahrtregelungen europäische Umweltzonen – Karlheinz-Jungbeck | ADAC e.V.
Der ADAC-Tourismuspräsident Karlheinz-Jungbeck führt zu den Einfahrtsregelungen in die deutschen und europäischen Umweltzonen aus. Bekanntermaßen ist die Europäische Union in diesem Kontext ein absoluter Flickenteppich, der aufgrund der Subsidiaritätsregelungen auch keine europaweit einheitliche Regelung erwarten lässt. Gleichzeitig ist eine Beschäftigung mit dem Thema erforderlich, da das durchschnittliche Fahrzeugalter stetig wächst. Zudem ist in den letzten Jahren verstärkt zu beobachten, wie Umweltthemen in Europa und den Mitgliedsstaaten immer stärker Mobilitätsthemen beeinflussen und mittlerweile sogar die Reisefreiheit einschränken. Ein aktuelles Beispiel ist das italienische Verbot zum Einsatz von Winterreifen ab dem 15. Mai eines Kalenderjahres mit Verweis auf Abrieb und Luftverschmutzung. Dieses pauschale Nutzungsverbot von Winterreifen ab dem 15. Mai steht im unmittelbaren Widerspruch zum Sicherheitsgedanken, denn der Brenner war in der ersten Maihälfte dieses Jahres noch mit Schnee bedeckt. Daher ist in der Gesellschaft eine Sensibilisierung notwendig, um Einschränkungen und overruling zu unterbinden. Der ADAC wird das Thema weiter verfolgen und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.
Mario de Rosa bittet zu prüfen, ob man auf europäischer Ebene und gemeinsam mit den europäischen Abgeordneten und Verbänden die Einführung der anerkannten Oldtimerdefinition in den relevanten Verordnungen und Richtlinien vorantreibt, um beispielsweise im Bereich der Umweltzonen eine europaweite geltende Grundlage zu schaffen. Dr. Jürgen Martens schätzt die Erfolgsaussichten einer entsprechenden
gemeinschaftlichen Regelung als gering ein, da subsidiär die Kommunen für die Regelung zuständig sind. Zielführender kann der Hinweis auf ein Diskriminierungsverbot sein. Denkbar wäre ein Hinweis, dass Fahrzeuge mit H-Kennzeichen in Deutschland vom Einfahrverbot in Umweltzonen ausgenommen sind und wenn in anderen EU-Ländern eine vergleichbare Regelung für historische Fahrzeuge besteht, diese Ausnahme auch den
deutschen H-Kennzeichen zu gewähren ist. Grundsätzlich kann dieser Hinweis auf das Diskriminierungsverbot jedoch nur Erfolg haben, wenn eine in etwa vergleichbare Regelung in dem Zielland auch existiert. Carsten Müller bittet zu prüfen, ob es möglicherweise Vorfälle in Frankreich gibt, bei denen deutsche Fahrzeuge mit H-Kennzeichen eine Einfahrt in Umweltzonen untersagt bzw. die Einfahrt sanktioniert wurde. Anhand dieser Fälle könnte eventuell die Durchsetzung des Diskriminierungsverbots geprüft werden. Dr. Gundula Tutt führt ergänzend aus, dass eine erfolgreiche Durchsetzung des Diskriminierungsverbots einen weiteren Anreiz für die
Zulassung eines historischen Fahrzeugs mit dem H-Kennzeichen sein könnte. Carsten Müller schlägt eine rechtliche Prüfung eines derartigen Vorgangs durch fachkompetente Vertreterinnen und Vertreter des Teilnehmerkreises vor. In einer der Folgesitzung des PAK könnte darüber berichtet werden.
TOP 6 Sachstand REACH – Chrom – Peter Diehl| kfz-betrieb
Peter Diehl berichtet, dass die europäische Chemikalienagentur ECHA im April einen Entwurf zur Beschränkung von Chrom(VI)-Verbindungen veröffentlichte. Diese Verbindungen werden künftig nicht mehr gemäß Anhang XIV der REACH-Verordnung (Zulassungen), sondern gemäß Anhang XVII (Beschränkungen) reglementiert. Die
Beschränkung soll im Jahr 2028 in Kraft treten und für alle Verwendungen dieser Stoffe gelten. Der Vorteil dieses Entwurfs ist die Tatsache, dass das vorherige Unbestimmte in den Chrom-Regelungen geordnet und sortiert wird. Darüber hinaus startet am 18. Juni 2025 ein mehrmonatiger, öffentlicher Konsultationsprozess mit Möglichkeit zur Stellungnahme. Es ist darauf zu achten, dass es bei REACH weiterhin um den gefahrenbasierten Ansatz gehen wird, der nicht das tatsächliche, sondern das potenzielle Risiko betrachtet. Die von Peter Diehl verwendete Präsentation liegt dem Protokoll bei. >TOP6 Vortrag Peter Diehl_Status quo Chrom_20250606
Dr. Gundula Tutt ergänzt, dass es sich bei dem hier regulierten Chrom um die Verbindung handelt, die im Außenbereich verwendet wird, beispielsweise für Stoßfänger. Grundsätzlich wurde es vergleichbares Verfahren seitens der ECHA bereits im Zusammenhang mit Blei durchgeführt. Der aktuelle Vorteil liegt jetzt darin, dass die
europäische Ebene durch die Debatten zu Blei bereits zur Erkenntnis gelangt sei, dass eine handwerkliche Nutzung von Chemikalien unterschiedlich zur industriellen Nutzung zu betrachten ist. Erkannt wurde auch, dass es historische Traditionshandwerke und – techniken gibt, die unter Einhaltung sicherheitsrelevanter Grundvoraussetzungen auf die weitere Verwendung bestimmter Gefahrenstoffen angewiesen sind und diese stets sehr verantwortungsbewusst nutzen. Auf die im Kontext Blei gewonnenen Diskussions- und Prozesserfahrungen kann in der aktuellen Debatte zielführend zurückgegriffen werden. Bedenklich ist, dass die Chemikaliennutzung und damit alle darauf basierenden Verfahren aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden sollen. Die Anwendung finden anschließend im nichteuropäischen Ausland statt. Die Folgen dieser Verlagerung besteht nicht nur im Verlust von Wissen und handwerklicher Kompetenzen, sondern auch in der massiven Erhöhung von Umweltbelastung und des CO2-Fußabdrucks, wenn Gegenstände und Bauteile zur Bearbeitung beispielsweise in die USA oder nach Indien hin und zurück transportiert werden. Auch diese Aspekte sind in die Diskussionen einzubringen. Der PAK wird die Entwicklung beobachten und sich mit allen Akteuren abgestimmt halten.
TOP 7 Verschiedenes
Neuregelung Reifenbindung Motorrad – Ulf Schulz | motorKosmos
Ulf Schulz trägt zur behördlichen Neuregelung der Nutzung von Reifen auf Motorräder vor. In der Vergangenheit stimmten Reifenhersteller und Fahrzeughersteller ihre Reifen auf Motorräder ab. Dazu gab es durch Reifen- und Motorradhersteller u.a. Prüfungen, Fahrtests, Zertifizierungen etc. Am Ende des Prüfprozesses standen Reifenvorgaben, Reifenbindung und Unbedenklichkeitsbescheinigung, welche bei Nutzung des Fabrikats entsprechend mitgeführt wurden. In der Betriebserlaubnis und/oder im Fahrzeugschein ist die Reifenbindung eingetragen. Seit Januar 2025 gibt es eine zentrale Veränderung. Auf Grundlage der EU-Verordnung Nr. 765/2008 über die „Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten“ wurde eine einheitliche europäische Regelung für Akkreditierungen geschaffen. Sie entfaltet ihre Wirkung auch im geschilderten Kontext. Auf Grundlage der Verordnung werden in die Papiere der Motorräder nun keine spezifischen Reifenfabrikate mehr eingetragen, sondern nur noch Größenangaben. Zusätzlich muss die davor in den Papieren eingetragene Reifenbindung ausgetragen werden. Der Aufwand ist enorm. Gleichzeitig ist kritisch, dass die Hersteller nun keine zertifizierten Reifenvorgaben mehr machen. Auch bei durchaus berechtigter Kritik an der alten, die Besitzerinnen und Besitzer einschränkenden Regelungen bei der Reifenwahl, ist zu berücksichtigen, dass die zertifizierte Vorgabe konkreter Reifenmodelle maßgeblich zu einer höheren Verkehrssicher beitrug. Deutlich wird der erkennbare Sicherheitsverlust an einem außergewöhnlichen, aber theoretisch nun möglichen Beispiel: Mit der schlichten Angabe der Reifengröße in den Fahrzeugpapieren kann theoretisch auf ein leistungsstarkes highend Sportmotorrad ein Stollenreifen aufgezogen werden. Beachtet werden muss einzig die Übereinstimmung mit der eingetragenen Reifengrößen. Darüber hinaus ist nun jedes Reifenfabrikat einsetzbar, was im Kontext der zahllosen Billighersteller ebenfalls keinen Sicherheitsgewinn darstellt. Abschließend müssen aufgrund der erforderlichen Ein- bzw. Austragung in den Papieren zusätzliche Termine und Wege in die Zulassungs- und Prüfstellen unternommen werden. In bestimmten Regionen ist das mit zusätzlichen, teils wochenlangen Wartezeiten und allgemein mit weiteren Kosten verbunden. Ganz besonders bei historischen Motorrädern kann es vorkommen, dass verfügbare Reifenmodelle nun über Einzelabnahmen bei den Prüforganisationen zu legitimieren sind. Insgesamt steht dem geringen Zugewinn an Wahlfreiheit der Reifenfabrikate ein möglicherweise sehr relevanter Sicherheitsverlust
sowie ein eventuell gar enormer bürokratischer Mehraufwand entgegen. Vorgeschlagen wird daher, die etablierte Regelung der Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) zu erhalten.
Sebastian Hoffmann gibt zu bedenken, dass selbst mit der früheren Reifenbindung nicht sichergestellt war, dass das verfügbare Reifenmodell dem ursprünglich geprüften Fabrikat entsprach – vor allem, wenn ein Modell Jahre und Jahrzehnte am Markt ist und sich im Laufe der Zeit Reifenmischungen und Herstellungsprozesse veränderten. Ulf Schulz verweist darauf, dass kein Reifenmodell eines namenhaften Herstellers über Jahrzehnte am Markt ist und falls Weiterentwicklungen auftreten, dann in Richtung Fortschritt und Verbesserung. Der einzige Zugewinn der Neuregelung wäre eine Flexibilität bei der Modellauswahl, die nach Überzeugung des Referenten dem erforderlichen Mehraufwand maßgeblich entgegensteht. Carsten Bräuer und Alf Menzel verweisen darauf, dass die Prüforganisation die gesetzlichen Regelungen umsetzen. Die Erfahrungen der Prüforganisation zeigen, dass die frühere Fabrikatsbindung nicht selten etwas willkürlich
eingetragen wurden. Im aktuellen Verfahren werden im Zuge des Prüfverfahrens die alten Eintragungen Stück für Stück überprüft. Am Ende wird häufig eine Austragung veranlasst. Michael Przibilski kritisiert die EU-Regelung als wenig zielführend, falls primär ein Hinzugewinn zur Verkehrssicherheit angestrebt wurde. In diesem Fall wäre eine Laufzeitbeschränkung für Reifen wesentlich wirkungsvoller. Manche, sehr alte Reifen
sehen optisch noch einsatzbereit aus, erweisen sich aber im Betrieb, etwa auf nasser Straße, als erheblich leistungseingeschränkt. Eine Laufzeitbeschränkung wäre hier wesentlich zielführender. Für historischen Fahrzeuge kommen die Reifenmodelle vor allem aus Tschechien und dem sächsischen Tal. Ein Billigangebot aus weit entfernten Regionen der Welt gibt es nicht.
>TOP7_Kradreifen_Neuregelung_2025_red
Sachstand „AG Fahrzeugidentitäten“ – Sebastian Hoffmann | FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH
Helmut Horn | tuning.de
Sebastian Hoffmann berichtet von den ersten beiden Treffen der Arbeitsgruppe Fahrzeugidentitäten. Nach diesen Treffen gibt es aktuell noch keine final ausformulierten und zusammengefassten Verbesserungs- oder Handlungsvorschläge. Aktuell ist die AG weiterhin dabei Sachstände zu ermitteln, aber kann erste Ideen präsentieren. Es hat sich gezeigt, dass es bereits zahlreiche Regelungen gibt, die helfen würden, gefälschte
Identitäten zu vermeiden. Nicht selten werden diese jedoch ignoriert. Eine entsprechende, bindende Handlungs- und Arbeitsanweisung wäre hier als Beitrag zur Vermeidung von gefälschten Identitäten zielführend. Ein Beispiel: Anfragen bei zehn großen Zulassungsstellen ergaben, dass die Zulassungsstellen beim Umgang mit neu
eingeschlagenen Fahrgestellnummern sehr unterschiedlich agieren. Die Einhaltung bereits existierender Regeln wäre ein Fortschritt zum Ist-Zustand und ein erstes erreichbares Zwischenziel.
Darüber hinaus werden die folgenden Punkte diskutiert: Zielführend wären klare Regelungen im Bereich Unfall und Fahrzeugaufbereitung, Verlust von Papieren, Ein- und Ausfuhr von Fahrzeugen, spezifische Identitätsprüfungen bei der Hauptuntersuchung bzw. der Oldtimerbegutachtung oder der Erteilung von Sonderkennzeichen. Wünschenswert wäre eine möglichste umfassende Fahrzeugdokumentation, denn teilweise haben Fahrzeuge vor Baujahr 1969 keine eingeschlagene Fahrzeugnummer, sondern werden über das leicht austauschbare Typenschild identifiziert. Zu kritisieren ist der Umstand, dass öffentliche Stellen die hinterlegten Fahrzeugdatensätze nach sieben bis zehn Jahren aus den amtlichen Datenbanken komplett löschen. Diese Löschung sollte umgehend beendet werden. Im Gegensatz dazu sollten amtlichen Datenbanken eher erweitert werden, beispielsweise mit spezifischen Fotodokumentation von definierenden Daten, wie etwa der Fahrgestellnummer. Das findet bei Abnahmen für H-Kennzeichen bereits immer häufiger Anwendung. Bestehende Verfahren könnten aufgegriffen und ausgeweitet werden, ohne dass ein enormer Mehraufwand zu betreiben wäre. Angelegt werden könnten die Daten in einem für alle Prüforganisationen zugänglichen Archiv. Mit diesem Archiv würde automatisch die Identität eines Fahrzeugs mehr Beachtung finden, wenn etwa
vorhandene Bilddaten von Fahrgestellnummern mit dem vorgeführten Fahrzeug abgeglichen werden können.
Wünschenswert wäre ein fälschungssicherer Identitätsnachweis zum Fahrzeug, zumal heute ein leicht zu manipulierender Kaufvertrag als Legitimierung ausreicht. Ein weiterer Aspekt betrifft den Verbleib von Fahrzeugen. Der Nachweis des Eigentümerwechsels wäre im hochpreisigen Segment besonders wünschenswert. Aktuell gibt es kein Kontrollmechanismus für Fahrzeuge, die wegen Unregelmäßigkeiten Gegenstand juristischer Auseinandersetzung wurden und durch zumindest fragwürdige Identitäten auffielen. Nicht selten tauchen diese Fahrzeuge nach möglichen juristischen Auseinandersetzung unmittelbar, mit zeitlichem Versatz oder über das Ausland so lange als neues Angebot wieder am Markt auf, bis eine potenzielle Käuferin oder ein potenzieller Käufer keine Bedenken oder Zweifel hat und das Fahrzeug als Original erwirbt. Absolut wünschenswert wäre eine Schiedsstelle zur Ausstellung eines Echtheitszertifikats. Ein ähnliches Angebot existiert bereits in der Schweiz. Dort wird von ausgewiesenen Expertinnen und Experten und in Zusammenarbeit mit der FIVA ein Echtheitszertifikat ausgestellt. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre es, den Handel mit Fahrzeugidentitäten,
Papieren und Typschildern durch gesetzgeberische Maßnahmen zu unterbinden.
Grundsätzlich sollte ein neu zugelassenes, aufgearbeitetes Fahrzeug aus mindestens 51 Prozent des Originalfahrzeugs bestehen – analog zu vergleichbaren Regelungen, etwa bei Geldscheinen. Ohne diese Regelung droht weiter der Umstand, dass aus einem historischen Fahrzeug, unzählige „neue“ Fahrzeuge herausrestauriert werden. Zu diskutieren wäre eine gesetzgeberische Initiative wonach etwa das Baujahr oder die Erstzulassung eines Fahrzeugs eine verbindlich zugesagte Eigenschaft des Fahrzeugs wird. So kann die Vorbesitzerin oder der Vorbesitzer sich nicht auf Nichtwissen zur falschen Identität berufen und auf eine eintretende Verjährung zu Lasten der Käuferin oder des Käufers hoffen.
Die Arbeit in der AG hat jedoch auch gezeigt, dass sich nicht die gesamte Szene hinter das Ziel stellt, den Betrug mit alten Fahrzeugen einzudämmen und zu verhindern. Für Einzelstimmen wiegt das ungestörte Geschäft schwerer, zumal hier mehrmals die äußerst anstößige These aufgestellt wurde, dass es den wohlhabenden Menschen schließlich egal sei, ob das im Besitz befindliche Fahrzeug ein Original oder nur eine Fälschung ist.
Angeblich sei hier nur der Besitz des Statussymbols an sich relevant. Ein weiterer geäußerter Ablehnungsgrund war die Annahme möglicher negativen Auswirkungen durch die verbrieften Erkenntnisse der AG-Arbeit. Potenzielle Käuferinnen und Käufer könnten durch die Debatten verunsichert werden. Im PAK wird jedoch gegenteilige Wirkung erwartet: Werden Betrugsfälle verhindert und illegale Geschäfte unterbunden oder
zumindest massiv eingeschränkt, werden die Oldtimerei und das historische Kulturgut verlässlich gestärkt.
In diesem Zusammenhang kündigt Carsten Müller an, den ermittlungsleitenden Beamten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg in den PAK einzuladen. Er wird ein allgemeines Lagebild auf Grundlage seiner Erkenntnisse aktueller Ermittlungen präsentieren. In diesem Kontext weist Carsten Müller ausdrücklich darauf hin, dass es in der Vergangenheit bereits mehrere zivilgerichtliche Feststellungen zu falschen
Fahrzeugidentitäten gegeben hat. Dies Sachverhalte sind festgestellt und stehen im Raum. Was es in der Tat bislang nicht gab, sind strafrechtliche Feststellungen. Grundsätzlich ist das hier angesprochene Feld ein weites und umfassendes, das viele Marken und Modelle aller Preiskategorien betrifft.
Berichtet wird zudem von einem gemeinsamen Telefonat dem ermittlungsleitenden Beamten und ihm mit dem Präsidenten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) sowie zwei Abteilungsleitern des KBA in jüngster Vergangenheit. Gegenstand waren Erkenntnisse aus aktuellen Ermittlungen und resultierende Handlungsoptionen, wie etwa einem Verdachtsregister bei einer staatlichen Behörde und dessen möglicher Ausgestaltung. Wichtig ist, dass das Register überhaupt nicht durchdekliniert sein, sondern es sich zunächst um ein gemeinsames Gedankenspiel in einem frühen Stadium zu möglichen Handlungsoptionen handelte, um den Identitätsfälschungen und den Betrügereien besser begegnen zu können. Auf Grundlage eines solchen Registers wäre es beispielsweise
denkbar, dass eine bei einem Zulassungsprozess auffällige Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) dazu führen könnte, eine Fahrzeugvorstellung zur Überprüfung zu veranlassen. Insgesamt hat das KBA einige Erkenntnisse aufgenommen. Zudem steht eine Weitergabe der Erkenntnisse an weitere Behörden zur Diskussion, um das Bewusstsein für die Lage auf breiter Basis zu schärfen.
Dr. Gundula Tutt ermutigt die AG zu einer entschlossenen Aufarbeitung. Die wenigen Einzelstimmen, die Betrug und Identitätsfälschungen billigend in Kauf nehmen, liefert exakt den Gegnern der Young- und Oldtimerszene etwas an die Hand, die sich gegen klar gegen Betrieb und Erhalt historische Fahrzeuge stellen. Klar ist: Eine Fälschung ist und bleibt Betrug, den es einzudämmen gilt. Bei Kunstverbänden existiert beispielsweise eine Regelung, wonach Verbandsmitglieder eine Meldung abgeben, sobald ein Verdacht auf Fälschung bei ihnen in der Werkstatt oder Galerie eingeht. Vergleichbares existiert in anderen Bereichen, bei denen häufiger Betrugsfälle auftreten, ebenfalls und gehört dort zur Berufsethik dazu. Ein Vorschlag für eine vergleichbare Regelung in der Oldtimerszene sollte einmal abgewogen werden, auch wenn er bereits Kritik in anderen Besprechungsrunden ausgelöst hat.
Carsten Müller unterstützt die Arbeit der AG uneingeschränkt und betont einen gewissen Handlungsdruck für die Beteiligten, denn wenn beispielsweise in einem konkreten Fall die Zulassung des nachweislichen Originalfahrzeugs durch die Zulassungsstelle verweigert wurde, weil mit den gleichen Fahrzeugdaten bereits ein nachweislich gefälschtes Fahrzeug zugelassen wurde und die Zulassungsstelle dagegen keinerlei Handhabe hat, dann ist zu handeln. Idealerweise gelingt es, wenn nutzbare Instrumente gegen Identitätsfälschungen geschaffen werden und diese dann nicht nur national, sondern möglicherweise sogar im europäischen Rahmen funktionieren. Angekündigt werden bereits weitere Gespräche mit maßgeblichen Akteuren, wie etwa dem Bundeskriminalamt (BKA), um das Thema voranzutreiben. Helmut Horn verweist auf das gegenwärtig
existierende Problem, dass vor dem Erwerb des Fahrzeugs keine Abfrage möglich ist, ob diese Fahrgestellnummer bereits zugelassen wurde, ob diese FIN überhaupt zu dem zum Kauf beabsichtigten Fahrzeug passt, denn die Hersteller verlangen zunächst den Eigentumsnachweis, bevor die FIN geprüft wird. Und selbst mit dem Herstellernachweis hat man lediglich den Nachweis, dass der Hersteller einmal ein Fahrzeug gebaut hat,
welches die angefragte FIN zugewiesen bekam. Es ist über diesen Nachweis aber nicht zertifiziert, dass das angefragte Fahrzeug auch tatsächlich das Original ist. Mika Hahn verweist auf die Situation, dass es historische Fahrzeuge auch von Herstellern gibt, die heute nicht mehr existieren und eine FIN-Abfrage bleibt ohne Adressaten. Aus dem Teilnehmerkreis werden mehrere Beispiele angeführt, bei denen auch Herstellerzertifikate
nicht unstrittig sind.
Carsten Müller kündigt an, dass die Sitzung, in der der LKA-Beamte berichten wird, keinen weiteren Tagesordnungspunkt umfassen wird, denn bereits die zahlreichen Diskussionen hier im PAK und auch der heutige Sachstandsbericht der AG Fahrzeugidentitäten verdeutlichen, wie umfänglich und facettenreich das Thema ist.
Peter Steckel berichtet von Schwierigkeiten, mit denen sich die Besitzer und Besitzerinnen von historischen Nutzfahrzeugen beim Finden einer Versicherung zunehmend konfrontiert sehen. Vor allem, wenn dem Nutzfahrzeug noch sein Arbeitsleben an der Karosserie anzusehen ist, wird häufiger kein Versicherungsanbieter gefunden. Marco Wenzel bietet hier Unterstützung an und steht für Anfragen zur Verfügung.